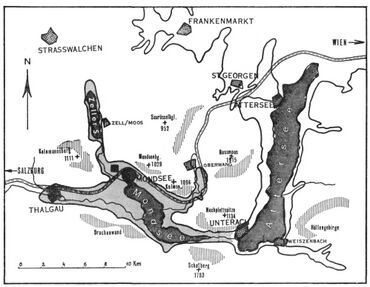|
|
| (975 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | Informationen zu ''[https://hydro.ooe.gv.at/#/overview/Wassertemperatur?period=P7D&filter=%7B%22web_gebiet%22%3A%22Traungebiet%22%7D Wasser- und Lufttemperatur]'' | | Informationen zu ''[https://hydro.ooe.gv.at/#/overview/Wassertemperatur?period=P7D&filter=%7B%22web_gebiet%22%3A%22Traungebiet%22%7D Wasser- und Lufttemperatur]'' |
| | | | |
| − | ==Die außergewöhnlichen Eigenschaften von Wasser== | + | ==Besonderheiten unseres Attersees== |
| | | | |
| − | ===Das Wasser der Erde=== | + | ===Die türkise Farbe des Attersees=== |
| − | | |
| − | Die Erde besitzt insgesamt 35 Milliarden km³ Wasser und bedeckt damit 71 % der Erdoberfläche – das sind 520 Millionen km².
| |
| − | | |
| − | Davon sind nur 24,3 Millionen km³ (= 0,7 ‰) in Form von Eis (Polareis, Gletscher, Schnee, Permafrost) und 10,5 Millionen km³ als Grundwasser vorhanden. Nur 122.000 km³ sind in Süßwasserseen, Bodenfeuchte, Mooren/Sümpfen und Flüssen enthalten. Die Atmosphäre trägt 12.900 km³ Wasser.
| |
| − | | |
| − | Hieraus lässt sich ermitteln, dass durch das Abschmelzen des Grönlandeises der Weltmeeresspiegel um rd. 6 m ansteigen würde. Unter der Annahme, dass alle Eismassen der Erde abschmelzen würden, stiege der Spiegel des Weltmeers um rd. 47 m an. (Anm.: Da der Meeresspiegel zum Höhepunkt der letzten Eiszeit um 120 m tiefer als heute lag, kann man schließen, dass damals gegenüber heute mehr als drei Mal so viel Wasser als Eis gebunden war.)
| |
| − | | |
| − | ===Dipol-Eigenschaft von Wassermolekülen===
| |
| − | | |
| − | Wassermoleküle bestehen aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom (H<sub>2</sub>O). Da die Wassersstoffatome bei der Elektronenpaarbindung ihre Elektronen an das Sauerstoffatom abgeben, zeigen sie elektrisch eine positive Ladung und das Sauerstoffatom eine doppelte negative Ladung.
| |
| − | | |
| − | Da sich die positiv geladenen Wasserstoffatome seitlich in einem Winkel von 104,5° an das negativ geladene Sauerstoffatom anlagern – und nicht entlang einer geraden Linie – wirkt das Wassermolekül elektrisch als ein Dipol.
| |
| − | | |
| − | [[Datei: Wasserstoffbrücken.png|thumb|340px|Wasserstoffbrücken durch Dipol-Dipol-Wechselwirkungen]]
| |
| − | | |
| − | ===Wasserstoffbrücken durch Dipol-Dipol-Wechselwirkungen===
| |
| − | | |
| − | Die Wassermoleküle richten sich nun so aus, dass die Plus- und die Minus-Teilladungen zueinander zeigen und damit die einzelnen Wassermoleküle durch die elektrischen Anziehungskräfte stark aneinander gebunden werden. Jedes elektropositive Wasserstoffatom eines Wassermoleküls versucht, möglichst in der Nähe eines elektronegativen Sauerstoffatoms eines anderen Moleküls zu sein (das sind die sogenannten "Wasserstoffbrücken"; vgl. die obige Abbildung).
| |
| − | | |
| − | Diese Wasserstoffbrückenbildung führt zu Clustern von Wassermolekülen. Je niedriger die Temperatur des Wassers, umso mehr lagern sich die Moleküle aneinander, je höher die Temperatur umso weniger Brücken gibt es.
| |
| − | | |
| − | ===Auswirkungen der Wasserstoffbrücken===
| |
| − | | |
| − | [[Datei: oberflaechenspannung.jpg|thumb|300px|Oberflächenspannung wegen Wasserstoffbrücken]]
| |
| − | | |
| − | Wie der nebenstehenden Grafik entnommen werden kann, heben sich die elektrischen Anziehungskräfte im Wasserinneren auf. Demgegenüber bildet sich an der Wasseroberfläche eine Schicht, bei der die Wassermoleküle für die (positiv geladenen) Wasserstoffatome keine Kompensation mehr finden und es bildet sich eine durch elektrische Kräfte gebildete Oberflächenspannung.
| |
| − | | |
| − | ===="Glücklicher" Aggregatzustand von Wasser====
| |
| − | | |
| − | Ohne diesen Dipolcharakter und den dadurch hervorgerufenen Wasserstoffbrücken, die die einzelnen Moleküle aneinander binden, wäre Wasser bei normalen Temperaturen keine Flüssigkeit sondern längst verdampft. Wasser hätte seinen '''''Schmelzpunkt bei –100 °C und den Siedepunkt bei –80 °C'''''. Es gäbe kein Leben auf der Erde.
| |
| − | | |
| − | ====Bildung von Wassertropfen und Regen====
| |
| − | | |
| − | Der obigen Grafik ist auch einfach zu entnehmen, dass sich bei ersten gebildeten Tropfen z.B. in einer Wolke an der Oberfläche eine positive elektrische Anziehungskraft der Wasserstoffatome für elektrisch negativ geladene Wasser-Sauerstoffatome in deren Nähe besteht und sich diese Wassermoleküle gerne an bestehende Wassertropfen angliedern - und damit das Wachsen von Regentropfen bewirken. Ohne diese Oberflächenspannung gäbe es keinen Regen, da sich keine größeren Wassertropfen bilden würden, deren Gewicht die Voraussetzung für Regen sind.
| |
| − | | |
| − | ===="Wasserläufer" sinken nicht ein====
| |
| − | | |
| − | [[Datei: Wasserläufer.png|thumb|150px|Oberflächenspannung]]
| |
| − | | |
| − | Wie in der Abbildung zu sehen ist, nutzen „Wasserläufer“ diese Oberflächenspannung, sodass sie über das Wasser laufen können ohne einzusinken. Zusätzlich haben sie Luftpolster an ihren Füßen, die ihnen zusätzlichen Auftrieb verleihen.
| |
| − | | |
| − | ===Dichte-Anomalie des flüssigen Wassers===
| |
| − | | |
| − | [[Datei: dichteanomalie flüssiges Wasser.jpg|thumb|260px| Dichteanomalie des flüssigen Wassers]]
| |
| − |
| |
| − | Nur bei Wasser steigt die Dichte beim Erwärmen von 0°C auf 4°C zunächst etwas an und beginnt erst dann zu sinken. Dieser Umstand ist lebensnotwendig für das Leben in Gewässern, denn das 4°C kalte Wasser sinkt nach unten. Die Gewässer können dadurch im Winter nicht vollständig durchfrieren und die Wassertiere können in der Nähe des Gewässerbodens überleben.
| |
| − | | |
| − | Die Dichteänderung von Wasser nimmt mit steigender Temperatur (vgl. die Grafik) rasch zu: Der Unterschied zwischen 24 und 25 °C ist dabei ungefähr 26-mal so groß, wie jener zwischen 4 und 5 °C. Als Faustregel kann gelten, dass Wasser bei 25 °C um rund 0,5 % leichter ist als bei 4 °C. Bei Seen resultiert daraus die große vertikale Schichtungsstabilität im Sommer.
| |
| − | | |
| − | Gleichzeitig bedeutet dies, dass nur im Frühjahr und im Spätherbst – wenn das (sauerstoffreiche) Oberflächenwasser und das Tiefenwasser gleiche Temperatur und damit gleiche Dichte haben – es zu einer Umwälzung des gesamten Seewassers kommt; nur dadurch wird ermöglicht, dass auch in großer Wassertiefe genügend Sauerstoff für Lebewesen vorhanden ist.
| |
| − | | |
| − | ===Dichte-Anomalie von Eis/Wasser===
| |
| − | | |
| − | Im Allgemeinen hat ein Stoff im festen Zustand eine größere Dichte als im geschmolzenen Zustand: Ein Eisenstück sinkt in einer Eisenschmelze genauso auf den Boden wie eine Kerze in flüssigem Wachs. Eis dagegen schwimmt auf flüssigem Wasser, denn die Dichte von Eis ist mit 0,92 g/cm<sup>3</sup> geringer als die Dichte von flüssigem Wasser (1 g/cm<sup>3</sup>). Eis ist daher bei 0 °C um rund 8,4 % leichter als Wasser. Dies bedingt auch, dass Seen von oben her zufrieren. Diese Anomalie ist darauf zurückzuführen, dass sich beim Gefrieren eine Gitterstruktur mit Hohlräumen bildet. In Form von Eis sind dadurch die Wasser-Teilchen weniger dicht gepackt als im flüssigen Wasser oder, was das gleiche bedeutet, Wasser dehnt sich beim Übergang in Eis um rund ein Elftel aus. Daher auch die Sprengwirkungen von in Rissen und Spalten gefrierendem Wasser.
| |
| − | | |
| − | ===Spezifische Wärme, Schmelzwärme und Verdunstungswärme===
| |
| − | | |
| − | Spezifische Warme ist die Energiemenge, um 1 kg eines Stoffes um 1 °C zu erwärmen. Bei Wasser ist das die Definition einer „Kilokalorie“ (= 4,1868 kJ) für die Erwärmung von 1 kg Wasser von 14,5 auf 15, 5 °C. Die vergleichsweise hohe spezifische Wärme von Wasser bedeutet, dass hohe Wärmemengen gespeichert werden und damit z.B. große Wasserkörper das Klima stark beeinflussen. Zugleich ergibt sich daraus, dass Wasser ein hohes thermisches Puffervermögen gegenüber tages- und/oder jahreszeitlichen Temperaturschwankungen besitzt.
| |
| − | | |
| − | Demgegenüber hat Eis eine geringere spezifische Wärme von 2,04 kJ/kg um (kaltes) Eis um 1 °C zu erwärmen. Die spezifische Schmelzwärme von Eis beträgt 335 kJ/kg.
| |
| − | | |
| − | Da beim Verdunsten die Wasserstoffbrücken überwunden werden müssen, lässt sich Wasser nur mit sehr hohem Energieaufwand verdunsten: um 1 Liter Wasser zu verdunsten sind 2.257 kJ Energie erforderlich.
| |
| − | | |
| − | ==Jährlich zweimalige Vollzirkulation des Atterseewassers==
| |
| − | | |
| − | Das gesamte Attersee-Wasser durchmischt sich wegen der Tiefe des Attersees zwei Mal pro Jahr (''"Vollzirkuation"'').
| |
| − | | |
| − | Im Sommer gibt es eine scharfe Trennung des warmen Oberflächenwassers gegenüber dem jahresdurchgängig 4 °C kalten Tiefenwasser.
| |
| − | | |
| − | [[Datei: Verdunstung 2.11.23.jpg|thumb|310px| Herbstliche Verdunstung am Attersee am 2.11.2023 bei Wassertemperatur 15 °C und Lufttemperatur 5 ° C]]
| |
| − | | |
| − | Im Herbst gibt der See seine Wärmeenergie vorrangig mittels Verdunstung an die kältere Luft ab. Da die Verdunstungswärme des Wassers sehr hoch ist, kommt diesem Effekt das Hauptgewicht der Wärmeabgabe zu (vgl. die nebenstehende Abbildung).
| |
| − | | |
| − | Im Verlauf des Winters kommt es dann zu einer Angleichung der Temperatur des Oberflächen- und des Tiefenwassers mit ca. 4 °C. Damit wird die '''''erste Zirkulation''''' des Wassers des gesamten Attersees ermöglicht, die durch Wind und Wellen begünstigt wird.
| |
| − | | |
| − | Im Verlauf des Winters kühlt das Oberflächenwasser weiter ab (von 4 °C auf bis zu 0 °C), sodass es wiederum zu einer Trennung von Oberflächen- und Tiefenwasser kommt.
| |
| − | | |
| − | Im Frühjahr kommt es mit der Erwärmung des Oberflächenwassers auf wiederum 4 °C zur gleichen Situation wie im Winter mit gleicher Temperatur von Oberflächen- und Tiefenwasser, sodass es zu einer '''''zweiten Zirkulation''''' des gesamten Atterseewassers kommt.
| |
| − | | |
| − | Diese zweifache Zirkulation des Seewassers bewirkt, dass auch in den kalten Tiefen des Attersees ganzjährig Wasser mit hohem Sauerstoffgehalt vorhanden ist.
| |
| − | | |
| − | Nur in diesem seit der Eiszeit '''''ganzjährig kalten und sauerstoffreichen Tiefenwasser unseres Attersees''''' konnten unsere eiszeitlichen Fischarten '''''<u>Reinanke</u>''''' und '''''<u>Seesaibling</u>''''' bis heute überleben: diese beiden Fischarten sind seit rd. 12.000 Jahren die einzigen direkten Nachkommen der Fische der Eiszeit in unserem damals erst entstandenen Attersee.
| |
| − | | |
| − | ----
| |
| − | | |
| − | In Seen mit geringer Wassertiefe kommt es zu keiner scharfen Trennung von Oberflächen- und Tiefenwasser, wenn das warme Oberflächenwasser bis zum Grund des Sees reicht. Damit wird dieser Wasserkörper täglich bis zum Grund durchmischt und hat in seiner gesamten Tiefe die gleiche Temperatur. Die Nachkommen der eiszeitlichen Salmoniden in diesen Seen – die '''''<u>Maränen</u>''''' – haben sich offenbar an diese Verhältnisse angepasst.
| |
| − | | |
| − | Da biologische Prozesse bei höheren Temperaturen rascher ablaufen – entsprechend einer Verdopplung je 10 ° Temperaturerhöhung – haben diese ''„<u>Warmwasser-Maränen</u>“'' einen höheren Stoffumsatz und wachsen schneller als die ''„<u>Kaltwasser-Salmoniden</u>“'' des Attersees.
| |
| − | | |
| − | ''[Anm. laut → '''[https://fischereirevier-attersee.at/renkenfischen/ Fischereirevier Attersee:]''' Die Fangtiefe für Attersee-Maränen liegt zw. 10 und 20 m. Tiefeneinstellung im Frühjahr 10–14 m; im Herbst 16–20 m. Im Frühjahr lohnt sich aber auch Flachwasser mit 5 m Wassertiefe.]''
| |
| − | | |
| − | ==Die türkise Farbe des Attersees== | |
| | | | |
| | [[Datei: Buchberg_from_Attersee.jpg|left|thumb|260px| Die milchig-türkise Färbung des Attersees ist eine Folge der biogenen Entkalkung.]] | | [[Datei: Buchberg_from_Attersee.jpg|left|thumb|260px| Die milchig-türkise Färbung des Attersees ist eine Folge der biogenen Entkalkung.]] |
| Zeile 114: |
Zeile 22: |
| | * CaCO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O → Ca<sup>2+</sup> + HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> + OH<sup>-</sup> (Hydrolyse von Calcit) | | * CaCO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O → Ca<sup>2+</sup> + HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> + OH<sup>-</sup> (Hydrolyse von Calcit) |
| | | | |
| − | Das Phytoplankton (= Algen) aber auch die Wasserpflanzen brauchen zur Photosynthese neben Lichtenergie vor allem Kohledioxid. Die Pflanzen und das Plankton entziehen dazu dem Wasser gelöstes '''''Kohlendioxid'''''. Damit entziehen sie dem Wasser Kohlensäure, die aus '''''Calciumhydrogencarbonat''''' nachgeliefert wird. Dadurch steigt auch der pH-Wert und das Wasser wird alkalischer. Das Calciumhydrogencarbonat zerfällt in Wasser und wasserunlösliches Calciumcarbonat, also Kalk, der in Form winziger - '''''weißer''''' - Kalkkristalle ausfällt. | + | Das Phytoplankton (= Algen) aber auch die Wasserpflanzen brauchen zur Photosynthese neben Lichtenergie vor allem Kohlendioxid. Die Pflanzen und das Plankton entziehen dazu dem Wasser gelöstes ''Kohlendioxid''. Damit entziehen sie dem Wasser Kohlensäure, die aus ''Calciumhydrogencarbonat'' nachgeliefert wird. Dadurch steigt auch der pH-Wert und das Wasser wird alkalischer. Das Calciumhydrogencarbonat zerfällt in Wasser und wasserunlösliches Calciumcarbonat, also Kalk, der in Form winziger - '''''weißer''''' - Kalkkristalle ausfällt. |
| | | | |
| | Diese Kalkkristalle geben dem Atterseewasser den '''''milchigen''''' Farbton. Das Grün des Chlorophylls des Phytoplanktons ergibt in Verbindung mit dem Blau des Himmels die '''''türkise''''' Grundfarbe. | | Diese Kalkkristalle geben dem Atterseewasser den '''''milchigen''''' Farbton. Das Grün des Chlorophylls des Phytoplanktons ergibt in Verbindung mit dem Blau des Himmels die '''''türkise''''' Grundfarbe. |
| Zeile 120: |
Zeile 28: |
| | Bei Wasserpflanzen (siehe z.B. in den Aufhamer Buchten) lagert sich das Calciumcarbonat als weißliche Kruste auf den Blättern und Stängeln ab. Durch die Tätigkeit des Phytoplanktons bilden sich im Wasser schwebende feine Kalkkristalle. Diese Kalkkristalle sinken ab und werden als ''Seekreide'' abgelagert. | | Bei Wasserpflanzen (siehe z.B. in den Aufhamer Buchten) lagert sich das Calciumcarbonat als weißliche Kruste auf den Blättern und Stängeln ab. Durch die Tätigkeit des Phytoplanktons bilden sich im Wasser schwebende feine Kalkkristalle. Diese Kalkkristalle sinken ab und werden als ''Seekreide'' abgelagert. |
| | | | |
| − | Die Zunahme der Calcitlöslichkeit im Wasser mit steigendem Druck und sinkender Temperatur bedingt aber, dass unterhalb einer kritischen Wassertiefe die Kalkkristalle aber wieder vollständig aufgelöst werden. | + | Die Zunahme der Calcitlöslichkeit im Wasser mit steigendem Druck und sinkender Temperatur bedingt aber, dass unterhalb einer kritischen Wassertiefe (ca. 30 m) die Kalkkristalle aber wieder vollständig aufgelöst werden. |
| | | | |
| | Literatur: | | Literatur: |
| Zeile 126: |
Zeile 34: |
| | * Moog 1982, Otto: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_6_1982_0134-0141.pdf Jahresgang von Phytoplankton und Chlorophyll a im Attersee 1981]'' – Arbeiten Labor Weyregg – 6_1982: 134–141 (Abb. S. 140) | | * Moog 1982, Otto: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_6_1982_0134-0141.pdf Jahresgang von Phytoplankton und Chlorophyll a im Attersee 1981]'' – Arbeiten Labor Weyregg – 6_1982: 134–141 (Abb. S. 140) |
| | * Butz 1996, Ilse, Schmid Anna-Maria: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_49_0085-0091.pdf Aqua-Schnee im Attersee?]''. Österreichs Fischerei 1996, S. 85–91. (Wasserchemie, Planktonarten, biologische Kalkausfällung) | | * Butz 1996, Ilse, Schmid Anna-Maria: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_49_0085-0091.pdf Aqua-Schnee im Attersee?]''. Österreichs Fischerei 1996, S. 85–91. (Wasserchemie, Planktonarten, biologische Kalkausfällung) |
| | + | * Schröder 1982, H.: → ''[ https://www.buchfreund.de/de/d/p/97403843/biogene-benthische-entkalkung-als-beitrag-zur Biogene benthische Entkalkung als Beitrag zur Genese limnischer Sedimente. Beisp.: Attersee (Salzkammergut, OÖ)]'' (Preis 16 €) |
| | | | |
| − | ==Arbeiten aus dem Labor Weyregg OFFEN== | + | ===Stehende Wellen am Attersee (und Traunsee)=== |
| | | | |
| − | Datenblatt → ''[https://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Dokumente%20UWD%20Abt_WW/Attersee_2007_bis_2009.pdf Attersee 2007–2009]''
| + | [[Datei: Stehende Wellen am Attersee und Traunsee.png|thumb|270px| Stehende Wellen am Attersee und Traunsee Attersee zeigt hier 3 Schwingungen pro Stunde]] |
| | | | |
| − | Limnologische Bibliographie zum Attersee: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/JOM_137_ErgBd_0204-0223.pdf 26 Literaturstellen bis 1980]''; viel von Univ. Göttingen.
| + | '''''Stehende Wellen''''' werden durch Luftdruckschwankungen ausgelöst, die eine Gleichgewichtsstörung der Wassermasse zur Folge haben; letztere ist bestrebt, den Gleichgewichtszustand wieder zu erreichen und pendelt nun um diesen mit einer ganz bestimmten Schwingungsdauer, die von der Form des Seebeckens abhängt, solange, bis wieder Ruhe eintritt, was oft erst nach Tagen der Fall ist. Vollständige Ruhe herrscht eigentlich kaum einmal, doch sind für gewöhnlich die Schwankungen so klein, daß sie nicht beachtet werden. Es werden auch Schwingungsknoten, sowie Längs- und Querschwingungen beobachtet. Die Schreibpegelanlagen des hydrographischen Dienstes haben lange Reihen solcher Schwingungen aufgezeichnet, von denen hier ein paar besonders schöne Beispiele wiedergegeben werden (s. Abb.). |
| | | | |
| − | Moog , Otto: → ''[https://www.researchgate.net/profile/Otto-Moog/publication/273453202_Attersee/links/5502b17f0cf231de076f49e1/Attersee.pdf Seenreinhaltung - Attersee.]'' (Daten, Limnologie etc.)
| + | Lit.: '''Rosenauer 1932''', Franz: → [https://www.zobodat.at/pdf/JOM_84_0335-0426.pdf Über das Wasser in Oberösterreich.] JBOÖMV Abb. 8. |
| − | | |
| − | Datenblatt → ''[https://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Dokumente%20UWD%20Abt_WW/Attersee_2007_bis_2009.pdf Attersee 2007–2009]''
| |
| | | | |
| − | WIKIWAND: → ''https://www.wikiwand.com/de/Region_Attersee''
| + | ===„Blasenwerfen“ eines Sees und Schlechtwettereinbruch?=== |
| | | | |
| − | ----
| + | Findenegg schreibt: "Bei uns in Kärnten gilt es als ein Vorzeichen kommenden Schlechtwetters, wenn der Seespiegel beim Rudern „Blasen wirft“ Es handelt sich bei dieser Erscheinung um Schaumblasen, die im Kielwasser des Bootes zurückbleiben und erst nach einigen Minuten bis zu einer halben Stunde wieder verschwinden. Die Erscheinung wird so gedeutet, daß die im Seewasser zu Millionen lebenden mikroskopisch kleinen Algen, das Phytoplankton, schleimartige Stoffe absondert, die sich unter gewissen Umständen, vor allem bei ruhigem Wasserspiegel, im Oberflächenhäutchen des Sees so stark anreichern, daß dieses die Eigenschaften etwa einer Seifenlösung erhält. Wird beim Rudern oder durch die Bugwellen des Bootes Luft ins Wasser gebracht, so kann diese nicht ohne weiteres wieder aus dem Wasser entweichen, sondern sammelt sich als Blase unter dem zähen Oberflächenhäutchen an, bis dieses wie eine Seifenblase „platzt“. |
| | | | |
| − | '''6 Bände: → ''[https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7054 Arbeiten aus dem Labor Weyregg]'''''
| + | Ich habe einige Jahre hindurch gelegentlich nach Tagen besonders deutlichen Blasenwerfens auf den weiteren Wetterverlauf geachtet und diesen notiert. Es sind im ganzen 21 Fälle. Nur in 4 Fällen folgte in den nächsten 48 Stunden Eintrübung oder Regenwetter. In 5 Fällen folgten noch am selben Tage oder doch innerhalb von 48 Stunden kurze Gewitter, in den übrigen 12 Fällen blieb das Wetter schön, meist sogar viele Tage lang. Daraus kann man wohl den Schluß ziehen, daß das Blasenwerfen mit dem Eintritt schlechter Witterung nichts zu tun hat. Es tritt vielmehr dann auf, wenn sich in der obersten Wasserschichte große Mengen von Planktonalgen ansammeln, was bei Windstille zeitweise der Fall ist. Daß das Blasenwerfen nicht immer, sondern nur periodenweise auftritt, hängt offenbar mit der Menge und Art der jeweils im See vorhandenen Algen zusammen, die im Laufe des Jahres stark wechseln. Daß es sich um keine Reaktion dieser Algen auf eine bestimmte Wetterlage handelt, dürfte aus den mitgeteilten Zahlen hervorgehen." |
| | | | |
| − | Moog 1982, Otto: → [https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=39276 Arbeiten aus dem Labor Weyregg 1982.]
| + | Lit.: Findenegg 1954, Ingo: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_7_0036-0037.pdf Blasenwerfen und Schlechtwetter?]'' – Österr. Fischerei – 7:36. |
| | | | |
| − | Schindlbauer, Gottfried: Agrargeographie des Atterseegebiets. Diss. 1981, Univ. Salzburg.
| + | ''['''Anm.:''' Das „Blasenwerfen“ der Seen vor Wetterverschlechterung hängt auch damit zusammen, dass bei <u>sinkendem Luftdruck</u> die im Wasser gelösten Gase ein neues Partialdruck-Gleichgewicht mit den Gasen der Luft anstreben, wodurch das „Ausgasen“ aus dem Seewasser begünstigt wird. Somit hat das „Blasenwerfen“ der Seen doch etwas mit kommendem Schlechtwetter zu tun – vor allem, wenn der Luftdruck <u>sehr rasch</u> sinkt.]'' |
| | | | |
| − | Schindlbauer 1982, Gottfried: → [https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_6_1982_0017-0056.pdf Das hydrographische Einzugsgebiet des Attersees – Geographische Untersuchungen als Grundlage für eine Nährstoffbilanzierung]. Arbeiten aus dem Labor Weyregg Bd. 6, 1982. S. 17–56. (einzelne Bäche mit Fläche, Bevölkerung, Landwirtschaft usw.) HQ LITERATUR zu Geologie, Hydrologie, Landwirtschaft usw. '''''[<u>Desciption of surface structure taking in consideration geology and nature of soil.</u>]'''''
| + | ==Die Entstehung und Abfolge der '''''vier''''' Atterseen== |
| | | | |
| − | Schindlbauer 1986, Gottfried: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/JOM_131a_0089-0105.pdf Das ländliche Siedlungsbild unter besonderer Berücksichtigung der Gehöftformen, dargestellt am Beispiel des Atterseegebietes.]'' JBOÖMV 1986, S. 89–105.
| + | ===Die vier Eiszeiten formen unsere Seenlandschaften=== |
| | | | |
| − | Moog 1982, Otto: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_6_1982_0134-0141.pdf Jahresgang von Phytoplankton und Chlorophyll a im Attersee 1981]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 6_1982: 134–141 (Abb. S. 140)
| + | [[Datei: Gliederung der Eiszeiten.png|thumb|340px|Gliederung der Eiszeiten: Zeiten, Temperaturen, Umfang; unser warmes Holozän beginnt plötzlich vor 11.700 Jahren]] |
| | | | |
| − | ----
| + | Die Bildung und Abfolge unserer Seen richtete sich jeweils nach den aufgetürmten Endmoränenwällen nach den vier Eiszeiten '''''Günz, Mindel, Riß und Würm''''' (vgl. die nebenstehende Abbildung): |
| | | | |
| − | Klima und Wetter: → ''[https://de.weatherspark.com/y/75346/Durchschnittswetter-in-Attersee-%C3%96sterreich-das-ganze-Jahr-%C3%BCber Das Klima und durchschnittliche Wetter das ganze Jahr über am Attersee]''
| + | Nach der Günz-Eiszeit bildeten sich vor etwa '''''600.000 Jahren die ersten Seen;''''' nach der Mindel-Eiszeit folgten vor '''''430.000 Jahren die zweiten Seen.''''' |
| | | | |
| | ---- | | ---- |
| | | | |
| − | ==Älteste Vermessung des Attersees SIMONY OFFEN==
| + | '''''Kohl 2001,''''' Hermann: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/OEKO_2001_3_0018-0028.pdf Das Eiszeitalter in Oberösterreich – Teil 1.]'' ÖKO.L Zs. für Ökologie, Natur- und Umweltschutz. 2001:18-28. (FARBBILD um den ATTERSEE !!!) |
| − | | |
| − | [[Datei: Vertikale Temperaturverteilung Attersee.png|thumb|210px| Vertikale Temperaturverteilung im Atter-, Mond-, Traun-, Hallstättersee]]
| |
| − | | |
| − | Grims 1996, Franz: → [https://www.zobodat.at/pdf/STAPFIA_0043_0043-0071.pdf Das wissenschaftliche Wirken Friedrich Simonys im Salzkammergut.] Staphia Bd. 43, S. 43-71.
| |
| − | | |
| − | Simony 1850, Friedrich: → ''[http://hdl.handle.net/21.11115/0000-000D-6632-8 Die Seen des Salzkammergutes]''. Sitzung vom 10. Mai 1850; Sitzungsberichte der math.-naturwiss. Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien. (Sprungschicht im Hallstättersee usw.)
| |
| | | | |
| − | Simony, 1879, Friedrich: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/SVVNWK_19_0525-0565.pdf Über Alpenseen]'' Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, Bd. 19, Wien 1879; 41 Seiten. (Tiefenmessungen; vertikale Temperaturmessungen usw.) <br /> "Dieselbe Erhebung findet sich in der Nähe von Nussdorf, wo aus dem 100 bis 150 Meter tiefen Seegrunde ein ziemlich umfangreicher Hügel bis gegen 60 Meter unter dem Wasserspiegel sich erhebt."
| + | '''''Kohl 2001.''''' Hermann: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/OEKO_2001_4_0026-0035.pdf Das Eiszeitalter in Oberösterreich – Teil 2.]'' ÖKO.L Zs. für Ökologie, Natur- und Umweltschutz. 2001:26-35. (BILD Abb. 2: Eisüberformtes Becken des Attersees. Die konkave Umformung der Hänge ist gut auf der rechten Bildseite (Umgebung NUSZDORF) zu erkennen.) (Korrekturen bei den Abb. von TEIL 1) |
| | | | |
| − | Simony hat diese Messungen 1848 durchgeführt (vgl. die Tabelle).
| + | '''''Ibetsberger 2010,''''' H.; Jäger, P.; Häupl. M.: → ''[http://www.geoglobe.at/DE/uploads/images/publikationen/27_Zerfall%20des%20Salzachgletschers.pdf Der Zerfall des Salzachgletschers und die nacheiszeitliche Entwicklung des Salzburger Gewässernetzes aus der Sicht der Wiederbesiedelung der Salzburger Gewässer mit Fischen]''. S. 7–54. Salzburger Landesregierung, Reihe Gewässerschutz Nr. 14. (auch ATTERSEE usw.) |
| | | | |
| − | Kartographische Kleinarbeit sind einige Tiefenkarten der von ihm ausgelotheten Seen, sie zeichnen sich durch minutiöse Zeichnung der Isobathen aus . Von Atter- und Mondsee liegen nur Pausen vor.
| + | '''''Schadler 1959,''''' Josef (Geologe): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_12_5-6_0036-0054.pdf Zur Geologie der Salzkammergutseen]'' – Österreichs Fischerei – 12:36–54. [auch zu Eiszeiten und Seenbildung] |
| | | | |
| − | Müllner (1898), Johann: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/MON-ALLGEMEIN_0197_0001-0114.pdf Die Seen des Salzkammergutes und die österreichische Traun]'' – Monografien Allgemein – 0197:1–114 (Attersee S. 21–25; Nußdorfer Berg im See (60 m); Niederschläge Attersee: S. 102–104).
| + | ===Der vor ~80.000 Jahren riesige Mondsee und der '''''dritte''''' Attersee=== |
| | | | |
| − | <gallery>
| + | [[Datei: Interglazialer Mondsee.jpeg|thumb|370px| Ausdehnung des interglazialen '''Mondsees''' vor > 80.000 Jahren]] |
| − | Attersee-Längsprofil.png| Attersee - Längsprofil|alt=alt language
| |
| − | Attersee-Querprofile.png| Attersee - Querprofile|alt=alt language
| |
| − | Attersee-See-Ende.png| Attersee - See-Ende|alt=alt language
| |
| − | Zellersee–Attersee.png| Zellersee bis Attersee|alt=alt language
| |
| − | </gallery>
| |
| | | | |
| − | ==Die jüngere Geschichte des Attersees==
| + | '''''Klaus 1975,''''' Wilhelm: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/JOM_120a_0315-0344.pdf Das Mondsee-Interglazial, ein neuer Florenfundpunkt der Ostalpen.]'' JBOÖMV 120a; 1975:315–344. |
| | | | |
| − | Ibetsberger 2010, H.; Jäger, P.; Häupl. M.: → ''[http://www.geoglobe.at/DE/uploads/images/publikationen/27_Zerfall%20des%20Salzachgletschers.pdf Der Zerfall des Salzachgletschers und die nacheiszeitliche Entwicklung des Salzburger Gewässernetzes aus der Sicht der Wiederbesiedelung der Salzburger Gewässer mit Fischen]''. S. 7–54. Salzburger Landesregierung, Reihe Gewässerschutz Nr. 14. (auch ATTERSEE usw.)
| + | Klaus und andere Geologen und Biologen haben anlässlich des Baus der Autobahn um den Mondsee in deren Höhe (rd. 560 m über NN) eindeutige Nachweise eines Sees ('''''Seetone,''''' die von Sanden und Moränengeschieben überlagert waren) vor rd. 80.000 Jahren gefunden. |
| | | | |
| − | Behbehani 1986, Ahmad; Müller, J.; Schmidt, R.; Schneider, J.; Schröder, H.; Strackenbrodk, I.; Sturm, M.: → ''[https://www.researchgate.net/publication/226673640_Sediments_and_sedimentary_history_of_Lake_Attersee_Salzkammergut_Austria/link/5646e30f08ae451880aabb9d/download Sediments and sedimentary history of Lake Attersee (Salzkammergut, Austria)]''. Hydrobiologia 143, December 1986, p. 233–246. ('''''Historia, Grafiken''''' usw.)
| + | Im Riß-Spätglazial gibt es zu Beginn vor allem Steppen-Vegetation und Nicht-Baum-Pollen. Das Riß/Würm-Interglazial selbst ist zu Beginn durch Kiefern/Birken, dann mit Kiefer/Birke/Ulme, dann Kiefer/Ulme/Esche und in der Folge von Wälder mit überwiegend Fichte, Ulmen, Erlen, Eschen und Eichen geprägt. In Interglazial-Mitte gibt es eine Hasel-Spitze, gefolgt von Eibe, Hainbuche und Tanne zugleich mit Fichte (vgl. das Pollendiagramm in Klaus S. 325) |
| | | | |
| − | S. 235: Grafik Delta: '''''Flysch vs. Moränen''''' !!! UND: ''''' 9.1 WIEDERBEWALDUNG'''''
| + | ---- |
| | | | |
| − | * Hydrobiologia articles are published open access under a CC BY licence (Creative Commons Attribution 4.0 International licence). → ''[https://www.springer.com/journal/10750/how-to-publish-with-us#Fees%20and%20Funding Creative Commons]''
| + | Nach der Riß-Eiszeit bildeten sich die dritten Seen: etwa der heutige Attersee und der damals '''''um 60 m höhere''''' (siehe Klaus 1975) '''''Mondsee''''' – der sich von Oberwang bis zum Zellersee und sogar bis nach Thalgau erstreckte (vgl. die Abbildung). |
| | | | |
| − | Der Attersee ist ein gutes Beispiel für einen See, der im nördlichen Vorland der Nördlichen Kalkalpen liegt und während des Postglazials von verschiedenen sedimentliefernden Prozessen beeinflusst wurde. Die Sedimente des Beckens bestehen aus mehreren Komponenten unterschiedlichen Ursprungs. Aus den Nördlichen Kalkalpen stammen Klastika, die hauptsächlich aus Dolomiten bestehen. Der klastische Eintrag von organischen und anorganischen Partikeln erfolgt durch Flüsse und Erdrutsche. Sie sind für den Haupteintrag von Silikaten wie Quarz, Feldspat und Glimmer verantwortlich. Ein großer Teil des Sediments stammt aus autochthonen biogenen Karbonatausfällungen. In den flachen sublitoralen Bereichen des nördlichen Teils des Sees dominiert die benthische Entkalkung durch verkrustende Makro- und Mikrophyten, während in den südlichen und zentralen Teilen des Sees die epilimnische Entkalkung durch die Blüte des Phytoplanktons im Sommer wichtiger ist. Die gesamte biogene Kalziumkarbonatproduktion erreicht etwa 11000 bis 12000 Tonnen pro Jahr. <br /> Nährstoffe und Rückstände von Cyanophyten (Oscillatoria rubescens) aus dem eutrophen Mondsee wurden von der Mondseeache in den Attersee gespült. Hohe Phosphorgehalte in den Sedimenten des südlichen Beckens weisen auf eine lokale Eutrophierung im Mündungsbereich der Mondseeache hin. Die durchschnittliche Sedimentationsrate im Attersee kann durch verschiedene Datierungsmethoden bestimmt werden. Die Sedimentationsraten stiegen in den letzten 110 Jahren von 1 mm pro Jahr auf 1,8 - 2 mm pro Jahr als Folge menschlicher Aktivitäten. Es lassen sich fünf Hauptphasen in der nacheiszeitlichen Sedimentationsgeschichte erkennen: Würmmoränen und fein gebänderte Varven (vor 13 000 v. Chr.), das frühe Attersee-Stadium (von 13.000 v. Chr. bis 1200 n. Chr.) und das spätere Attersee-Stadium nach der bayerischen Besiedlung (ab 1200 v. Chr.). Mit Hilfe von Schwermetall- und Isotopenanalysen kann die Sedimentationsgeschichte für die letzten 100 Jahre genauer rekonstruiert werden.
| + | Es gibt Hypothesen ('''''Ibetsberger 2010'''''), die sich insbesondere auf Kohl (2000:149) beziehen, dass damals (vor ca. 80.000 Jahren) der '''''Mondsee und der Attersee einen gemeinsamen See''''' mit einer Seehöhe von 560 m über NN gebildet hätten. Das war aber nicht möglich, da die Riß-Moräne des Attersees – die heute etwa bei Lenzing liegt – nicht die erforderliche Höhe von zumindest 560 m hatte. Entsprechend den Höhenschichtlinien in '''''DORIS''''' hat diese Moräne eine '''''maximale Höhe von 500 m über NN.''''' Daraus ergibt sich, dass es '''''<u>keinen gemeinsamen See aus Mond- und Attersee</u>''''' geben haben konnte, da ja dann der Mondsee keine Höhe von 560 m hätte haben können. Dies bedeutet wahrscheinlich auch, dass der damals riesige Mondsee ursprünglich nach Norden zur Salzach entwässerte. |
| | | | |
| − | Schneider 1990,J., Röhrs J., Jäger P.: → ''[https://www.researchgate.net/publication/226673640_Sediments_and_sedimentary_history_of_Lake_Attersee_Salzkammergut_Austria Sedimentation and Eutrophication History of Austrian Alpine Lakes.]'' In: Tilzer m. (1990): Large Lakes. Ecological Structure and Funktion. Springer Berlin, ISBN 978-3-642-84079-1; p. 316-335. (ATTERSEE letzte 15.000 Jahre)
| + | ===Unser heutiger '''''vierter''''' Attersees=== |
| | | | |
| − | * Within Austrian prealpine lakes the first natural eutrophication can be identified about 6,000 yr B. P.
| + | Die Erniedrigung der Barriere zwischen Mondsee und Attersee muss sich gegen Ende des Riß/Würm-Interglazials oder erst durch den Würm-Gletscher während der letzten Eiszeit durch Abtragen von rd. 60 Höhenmetern Material bei See/Mondsee ereignet haben, mit der sich die '''''vierten (heutigen) Seen Mondsee und Attersee''''' etwa in heutiger Gestalt gebildet haben. |
| | | | |
| − | Schneider 1987, J., Müller, J., & Sturm, M.: Die sedimentologische Entwicklung des Attersees und des Traunsees im Spät- und Postglazial. Mitt. d. Komm. f. Quartärforschung der ÖAW, 7, Wien, 51–78
| + | ==Die sedimentologische Entwicklung des Attersees seit der Eiszeit OFFEN== |
| | | | |
| − | ==Stehende Wellen am Attersee (und Traunsee)==
| + | Der Attersee ist ein Beispiel für einen See, der im nördlichen Vorland der Nördlichen Kalkalpen liegt und während des Postglazials von verschiedenen sedimentliefernden Prozessen beeinflusst wurde. Die Sedimente des Beckens bestehen aus mehreren Komponenten unterschiedlichen Ursprungs. |
| | | | |
| − | [[Datei: Stehende Wellen am Attersee und Traunsee.png|thumb|270px| Stehende Wellen am Attersee und Traunsee]]
| + | Aus den Nördlichen Kalkalpen stammen Klastika, die hauptsächlich aus Dolomit bestehen. Der klastische Eintrag von organischen und anorganischen Partikeln erfolgt durch Flüsse und Erdrutsche. Sie sind für den Haupteintrag von Silikaten wie Quarz, Feldspat und Glimmer verantwortlich. Ein großer Teil des Sediments stammt aus autochthonen biogenen Karbonatausfällungen. |
| | | | |
| − | '''Stehende Wellen:''' Wie bekannt, werden sie durch Luftdruckschwankungen ausgelöst, die eine Gleichgewichtsstörung der Wassermasse zur Folge haben; letztere ist bestrebt, den Gleichgewichtszustand wieder zu erreichen und pendelt nun um diesen mit einer ganz bestimmten Schwingungsdauer, die von der Form des Seebeckens abhängt, solange, bis wieder Ruhe eintritt, was oft erst nach Tagen der Fall ist. Vollständige Ruhe herrscht eigentlich kaum einmal, doch sind für gewöhnlich die Schwankungen so klein, daß sie nicht beachtet werden. Es werden auch Schwingungsknoten, sowie Längs- und Querschwingungen beobachtet. Die Schreibpegelanlagen des hydrographischen Dienstes haben lange Reihen solcher Schwingungen aufgezeichnet, von denen ein paar besonders schöne Beispiele hier wiedergegeben werden (Abb.).
| + | In den flachen sublitoralen Bereichen des nördlichen Teils des Sees dominiert die benthische Entkalkung durch verkrustende Makro- und Mikrophyten, während in den südlichen und zentralen Teilen des Sees die epilimnische Entkalkung durch die Blüte des Phytoplanktons im Sommer wichtiger ist. Die gesamte biogene Kalziumkarbonatproduktion erreicht etwa 11.000 bis 12.000 Tonnen pro Jahr. |
| | | | |
| − | Lit.: '''Rosenauer 1932''', Franz: → [https://www.zobodat.at/pdf/JOM_84_0335-0426.pdf Über das Wasser in Oberösterreich.] JBOÖMV Abb. 8.
| + | Nährstoffe und Rückstände von Cyanophyten (Oscillatoria rubescens) aus dem eutrophen Mondsee wurden von der Mondseeache in den Attersee gespült. Hohe Phosphorgehalte in den Sedimenten des südlichen Beckens weisen auf eine lokale Eutrophierung im Mündungsbereich der Mondseeache hin. Die durchschnittliche Sedimentationsrate im Attersee kann durch verschiedene Datierungsmethoden bestimmt werden. Die Sedimentationsraten stiegen in den letzten 110 Jahren von 1 mm pro Jahr auf 1,8 - 2 mm pro Jahr als Folge menschlicher Aktivitäten. |
| | | | |
| − | ==Tauchparadies Attersee==
| + | Es lassen sich fünf Hauptphasen in der nacheiszeitlichen Sedimentationsgeschichte erkennen: Würmmoränen und fein gebänderte Varven (vor 13 000 v. Chr.), das frühe Attersee-Stadium (von 13.000 v. Chr. bis 800 n. Chr.) und das spätere Attersee-Stadium nach der bayerischen Besiedlung (ab 800 n. Chr.). Mit Hilfe von Schwermetall- und Isotopenanalysen kann die Sedimentationsgeschichte für die letzten 100 Jahre genauer rekonstruiert werden. |
| | | | |
| − | Hois 2014, Harald, Kapfer Gerald: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0033_0009-0032.pdf Unterwasser - ein fotografischer Streifzug durch Seen, Flüsse und Bäche entlang der Ostalpen.]'' Zs. Denisia Bd. 33:9–32. (phänomenale Unterwasser-Bilder: S. 23–26)
| + | ---- |
| | | | |
| − | Der Attersee gilt als Tauchmekka im Salzkammergut sowie im deutschsprachigen Raum. Der See gilt als das vielfältigste Tauchgewässer Österreichs und zählt zu den besten Süßwasser-Destinationen weltweit. Die Auswahl an Foto-Standorten richtet sich ganz nach den Wünschen der Fotografen: von der Architektur der Unterwasserkuppeln, Anlegestellen (Abb. 26) und Bootshäuser hin bis zu senkrecht abfallenden Steilwänden oder auch zu opulent bewachsenen Abhängen und Uferzonen reicht das Spektrum. Doch damit noch nicht genug: <br /> Schwarmphänomene wie der jährliche Laichzug der bis zu 1 m großen Perlfische (Abb. 27) oder die Millionen an Seelauben (Abb. 28) an den Hinkelsteinen sowie an weiteren Bachmündungen machen den Attersee einzigartig. <br /> Die Infrastruktur des Attersees geht soweit, dass neben den vielen Tauchschulen mittlerweile auch Arbeitstauchunternehmen am See Fuß gefasst haben. Die Ausbildung von Arbeitstauchern (Schweißen, Schremmen, Schneiden, Saugen u. v. m.) steht ebenso am Ausbildungsplan, wie der Umgang mit unterschiedlichen Atemgassen für die Offshore-Taucherei (Abb. 29).
| + | '''''Behbehani, A. R., 1984:''''' Sedimentologische Untersuchungen im südlichen Teil des Attersees (Österr. Kt. 1:25 000, Bl. 64/4 Unterach, Salzkammergut, Oberösterreich). Diplomarbeit, Univ. Göttingen, 137 p. |
| | | | |
| − | ==Die Fische des Attersees==
| + | '''''Behbehani 1986,''''' Ahmad; Müller, J.; Schmidt, R.; '''Schneider, J.'''; Schröder, H.; Strackenbrodk, I.; Sturm, M.: → ''[https://www.researchgate.net/publication/226673640_Sediments_and_sedimentary_history_of_Lake_Attersee_Salzkammergut_Austria/link/5646e30f08ae451880aabb9d/download Sediments and sedimentary history of Lake Attersee (Salzkammergut, Austria)]''. Hydrobiologia 143, December 1986, p. 233–246. ('''''Historia, Grafiken''''' usw.) → S. 235: Grafik Delta: '''''Flysch vs. Moränen''''' !!! UND: ''''' 9.1 WIEDERBEWALDUNG''''' |
| | | | |
| − | ===Die älteste Entwicklung der Fischarten===
| + | * Hydrobiologia articles are published open access under a CC BY licence (Creative Commons Attribution 4.0 International licence). → ''[https://www.springer.com/journal/10750/how-to-publish-with-us#Fees%20and%20Funding Creative Commons]'' |
| | | | |
| − | [[Datei: Evolution der europäischen Fischfauna.png|thumb|200px| Evolution der europäischen Fischfauna in den Erdzeitaltern]]
| + | '''Schneider 1987, J.''', Müller, J., & Sturm, M.: Die sedimentologische Entwicklung des Attersees und des Traunsees im Spät- und Postglazial. Mitt. d. Komm. f. Quartärforschung der ÖAW, 7, Wien, 51–78 |
| | | | |
| − | Gerolf Steiner (1960): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_13_0135-0141.pdf Vierhundertfünfzig Millionen Jahre Fische – Teil 1]'' – Österreichs Fischerei – 13:135–141. (450.000.000 Jahre)
| + | '''Schneider 1990,J.''', Röhrs J., Jäger P.: → [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-84077-7_16 Sedimentation and Eutrophication History of Austrian Alpine Lakes]. In: Tilzer m. (1990): Large Lakes. Ecological Structure and Funktion. Springer Berlin, ISBN 978-3-642-84079-1; p. 316-335. (ATTERSEE letzte 15.000 Jahre) |
| | | | |
| − | Gerolf Steiner (1961): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_14_0008-0015.pdf Vierhundertfünfzig Millionen Jahre Fische – Teil 2]'' – Österreichs Fischerei – 14:8–15. (Tolle Bilder)
| + | * Within Austrian prealpine lakes the first natural eutrophication can be identified about 6,000 yr B. P. The Neolithic and the Roman colonizations had nearly no influence on these large lakes. |
| | | | |
| − | Jäger 2010,P; Häupl M.; Ibetsberger, H.: → ''[http://www.geoglobe.at/DE/uploads/images/publikationen/28_nacheiszeitliche%20Wiederbesiedlung.pdf Die nacheiszeitliche Wiederbesiedlung der Salzburger Gewässer mit Fischen]''. Land Salzburg, Reihe Gewässerschutz Nr. 14; 2010:55–90.
| + | ==Älteste Vermessung des Attersees SIMONY OFFEN== |
| | | | |
| − | Friedrich Morton (1961): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_14_0065-0067.pdf Fischfang im Salzkammergut seit viertausend-fünfhundert Jahren!]'' – Österreichs Fischerei – 14:65–67 (Pfahlbauern usw.)
| + | [[Datei: Vertikale Temperaturverteilung Attersee.png|thumb|210px| Vertikale Temperaturverteilung im Atter-, Mond-, Traun-, Hallstättersee]] |
| | | | |
| − | ===Besiedlung des Attersees nach der Eiszeit===
| + | '''''Grims 1996,''''' Franz: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/STAPFIA_0043_0043-0071.pdf Das wissenschaftliche Wirken Friedrich Simonys im Salzkammergut.]'' Staphia Bd. 43, S. 43-71. |
| | | | |
| − | Ibetsberger 2010, H.; Jäger, P.; Häupl. M.: → ''[http://www.geoglobe.at/DE/uploads/images/publikationen/27_Zerfall%20des%20Salzachgletschers.pdf Der Zerfall des Salzachgletschers und die nacheiszeitliche Entwicklung des Salzburger Gewässernetzes aus der Sicht der Wiederbesiedelung der Salzburger Gewässer mit Fischen]''. S. 7–54. Salzburger Landesregierung, Reihe Gewässerschutz Nr. 14. (auch ATTERSEE usw.)
| + | '''''Simony 1850,''''' Friedrich: → ''[http://hdl.handle.net/21.11115/0000-000D-6632-8 Die Seen des Salzkammergutes]''. Sitzung vom 10. Mai 1850; Sitzungsberichte der math.-naturwiss. Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien. (Sprungschicht im Hallstättersee usw.) |
| | | | |
| − | Jäger 2010,P; Häupl M.; Ibetsberger, H.: → ''[http://www.geoglobe.at/DE/uploads/images/publikationen/28_nacheiszeitliche%20Wiederbesiedlung.pdf Die nacheiszeitliche Wiederbesiedlung der Salzburger Gewässer mit Fischen]''. Land Salzburg, Reihe Gewässerschutz Nr. 14; 2010:55–90. <br />
| + | '''''Simony, 1879,''''' Friedrich: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/SVVNWK_19_0525-0565.pdf Über Alpenseen]'' Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, Bd. 19, Wien 1879; 41 Seiten. (Tiefenmessungen; vertikale Temperaturmessungen usw.) <br /> "Dieselbe Erhebung findet sich in der Nähe von Nussdorf, wo aus dem 100 bis 150 Meter tiefen Seegrunde ein ziemlich umfangreicher Hügel bis gegen 60 Meter unter dem Wasserspiegel sich erhebt." |
| − | S. 69: Attersee Klarwasserphase vor ca. 17.000 Jahren: Beginn einer Kaltwasser-Fischbesiedlung in Ager bis Schörfling; in der Folge bis spätestens vor 14.500 Jahren auch im Attersee. Um 10.000 Jahren vor heute gibt es den gemischen Kalt- und Warmwasserfischbestand im Attersee.
| |
| | | | |
| − | ===Die beiden geschützten Fischarten===
| + | Simony hat diese Messungen 1848 durchgeführt (vgl. die Tabelle). |
| | | | |
| − | [[Datei: Perlfisch-Innerschwand.jpg|thumb|210px| Laichzug der Perlfische Seeache aufwärts Ende April–Anfang Mai]]
| + | Kartographische Kleinarbeit sind einige Tiefenkarten der von ihm ausgelotheten Seen, sie zeichnen sich durch minutiöse Zeichnung der Isobathen aus . Von Atter- und Mondsee liegen nur Pausen vor. |
| | | | |
| − | [[Datei: Perlfischpopulation.png|thumb|380px| Individuenzahl, Gewicht Perlfischpopulation: Attersee / Mondsee]] | + | '''''Müllner 1898,''''' Johann: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/MON-ALLGEMEIN_0197_0001-0114.pdf Die Seen des Salzkammergutes und die österreichische Traun]'' – Monografien Allgemein – 0197:1–114 (Attersee S. 21–25; Nußdorfer Berg im See (60 m); Niederschläge Attersee: S. 102–104). |
| | | | |
| − | Schmall 2010, B. & Ratschan, C.: → ''[https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/naturschutz_db/Rutilus_meidingeri_Perlfisch_11_01_10.pdf Perlfisch Rutilus meidingeri]''. In: Digitaler Fischartenatlas von Deutschland und Österreich 2010; 43 Seiten. (ganz ausgezeichnete Darstellung!)
| + | <gallery> |
| | + | Attersee-Längsprofil.png| Attersee - Längsprofil|alt=alt language |
| | + | Attersee-Querprofile.png| Attersee - Querprofile|alt=alt language |
| | + | Attersee-See-Ende.png| Attersee - See-Ende|alt=alt language |
| | + | Zellersee–Attersee.png| Zellersee bis Attersee|alt=alt language |
| | + | </gallery> |
| | | | |
| − | Sigliato 2005, Simonetta & Gumpinger, Clemens: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/OEKO_2005_3_0003-0009.pdf Der Perlfisch – Eine weltweite zoologische Rarität im Mondsee-Attersee-Gebiet.]'' ÖKO·L 27/3 (2005): S. 3-9. (Reusen; Seelaube; Beifänge)
| + | ==Arbeiten aus dem Labor Weyregg zur Seereinhaltung OFFEN== |
| | | | |
| − | Mayr 2006, St.; Wanzenböck, J.: → ''[https://www.researchgate.net/publication/258437545_Der_Perlfisch_Rutilus_meidingeri_Heckel_1851_ein_Tiefwasserbewohner_unserer_Seen_Mythos_oder_Wahrheit_-_Seine_Habitatnutzung_und_Nahrungswahl_im_Mondsee Der Perlfisch (Rutilus meidingeri (Heckel, 1851)), ein Tiefwasserbewohner unserer Seen: Mythos oder Wahrheit? - Seine Habitatnutzung und Nahrungswahl im Mondsee.] Österreichs Fischerei, 2006: 262– 272. 12 Seiten.
| + | Datenblatt → ''[https://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Dokumente%20UWD%20Abt_WW/Attersee_2007_bis_2009.pdf Attersee 2007–2009]'' |
| | | | |
| − | Mayr 2007, Stefan; Josef Wanzenböck (2007): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_60_0228-0235.pdf Wachstum, Längen-Gewichts-Beziehung und Konditionsfaktor des Perlfisches (Rutilus meidingeri im Mondsee]'' – Österreichs Fischerei – 60: 228–235.
| + | Limnologische Bibliographie zum Attersee: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/JOM_137_ErgBd_0204-0223.pdf 26 Literaturstellen bis 1980]''; viel von Univ. Göttingen. |
| | | | |
| − | Hauer 2014, Wolfgang: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_67_0067-0071.pdf Perlfisch, Aitel oder Hasel]''. Österreichs Fischerei 2014, S. 67–71
| + | Moog , Otto: → ''[https://www.researchgate.net/profile/Otto-Moog/publication/273453202_Attersee/links/5502b17f0cf231de076f49e1/Attersee.pdf Seenreinhaltung - Attersee.]'' (Daten, Limnologie etc.) |
| | | | |
| − | Landesfischereiverband OÖ: → ''[https://www.lfvooe.at/fische/perlfisch/ Perlfisch Rutilus meidingeri]'' (Unterscheidung vom Aitel)
| + | Datenblatt → ''[https://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Dokumente%20UWD%20Abt_WW/Attersee_2007_bis_2009.pdf Attersee 2007–2009]'' |
| | | | |
| − | Erich Kainz 1997, Hans; Kainz, Erich: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_50_0091-0098.pdf Beiträge zur Biologie und Aufzucht des Perlfisches Rutilus frisii meidingeri]'' – Österreichs Fischerei – 50:91–98.
| + | WIKIWAND: → ''https://www.wikiwand.com/de/Region_Attersee'' |
| − | | |
| − | Fuchs 1999, Helmut et al.: → [https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_52_0057-0062.pdf Untersuchung von Perlfischen (Rutilus frisii meidingeri, Heckel) aus dem Wolfgangsee und dem Attersee auf genetische Unterschiede mit molekulargenetischen Markern] – Österreichs Fischerei – 52:57–62.
| |
| − | | |
| − | Siligato 2006, Simoetta et Clemens Gumpinger (2006): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_59_0011-0019.pdf Zur Laichwanderung des Perlfisches (Rutilus meidingeri) in die Seeache zwischen Mondsee und Attersee]'' – Österreichs Fischerei – 59:11–19. (Perlfisch und Seelaube; alle Atterseefische in der Seeache!)
| |
| − | | |
| − | Schrempf 2006, Renate: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_59_0201-0207.pdf Genetische Untersuchungen der österreichischen Perlfisch-Populationen (Rutilus frisii meidingeri) mittels RFLP]'' – Österreichs Fischerei – 59: 201 - 207.
| |
| | | | |
| | ---- | | ---- |
| | | | |
| − | Hauer 1997, Wolfgang: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_50_0210.pdf Seelaube, Mairenke, Schiedling (Chalcalburnus chalcoides mento).]'' Österreichs Fischerei 1997, S. 210. (Abbildung)
| + | '''6 Bände: → ''[https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7054 Arbeiten aus dem Labor Weyregg]''''' |
| | | | |
| − | Landesfischereiverband OÖ: → ''[https://www.lfvooe.at/fische/seelaube/ Seelaube (Mairenke, Schiedling) Alburnus mento]'' (Unterscheidung von Laube und Rapfen)
| + | Moog 1982, Otto: → [https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=39276 Arbeiten aus dem Labor Weyregg 1982.] |
| | | | |
| − | ===Reinanken – Felchen – Maränen ===
| + | Schindlbauer, Gottfried: Agrargeographie des Atterseegebiets. Diss. 1981, Univ. Salzburg. |
| | | | |
| − | [[Datei: Wolfgang Abel.png|thumb|120px| ]] | + | Schindlbauer 1982, Gottfried: → [https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_6_1982_0017-0056.pdf Das hydrographische Einzugsgebiet des Attersees – Geographische Untersuchungen als Grundlage für eine Nährstoffbilanzierung]. Arbeiten aus dem Labor Weyregg Bd. 6, 1982. S. 17–56. (einzelne Bäche mit Fläche, Bevölkerung, Landwirtschaft usw.) HQ LITERATUR zu Geologie, Hydrologie, Landwirtschaft usw. '''''[<u>Desciption of surface structure taking in consideration geology and nature of soil.</u>]''''' |
| | | | |
| − | [[Datei: Burgunderblutalgen.png|thumb|190px|Blutalgen: Foto von A. Jagsch]] | + | Schindlbauer 1986, Gottfried: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/JOM_131a_0089-0105.pdf Das ländliche Siedlungsbild unter besonderer Berücksichtigung der Gehöftformen, dargestellt am Beispiel des Atterseegebietes.]'' JBOÖMV 1986, S. 89–105. |
| | | | |
| − | [[Datei: Reinanken, Maränen, Felchen.png|thumb|190px|Namen und Verbreitung von Reinanken, Felchen, Maränen]] | + | Moog 1982, Otto: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_6_1982_0134-0141.pdf Jahresgang von Phytoplankton und Chlorophyll a im Attersee 1981]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 6_1982: 134–141 (Abb. S. 140) |
| | | | |
| − | [[Datei: Kröpfling.png|thumb|270px| Coregonus hiemalis Jur. Kilch oder Kröpfling <br /> Riesenbauch wg. geplatzter Schwimmblase]]
| + | ---- |
| | | | |
| − | Wagler 1941, E.:→ ''[https://www.zobodat.at/pdf/VeroeffZSM_001_0003-0062.pdf '''Die Coregonen.'''''] In: Demoll-Maier: Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas. S.371-501. ('''''Herkunft, Arten; Attersee''''' usw.)
| + | Klima und Wetter: → ''[https://de.weatherspark.com/y/75346/Durchschnittswetter-in-Attersee-%C3%96sterreich-das-ganze-Jahr-%C3%BCber Das Klima und durchschnittliche Wetter das ganze Jahr über am Attersee]'' |
| | | | |
| − | Siebold 1863, Carl Theodor Ernst von: → ''[https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/siebold_suesswasserfische_1863?p=78 Die Süsswasserfische von Mitteleuropa]''. Leipzig 1863:251–279. <br />
| + | ---- |
| − | 1. Renke → ''[https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/siebold_suesswasserfische_1863/?hl=Coregonen;p=256 (Coregonus Wartmanni)]'' <br />
| |
| − | 2. Bodenrenke → ''[https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/siebold_suesswasserfische_1863/?hl=Coregonen;p=264 (Coreg. Fera)]'' (S. 267 Anm.: konkrete Nachforschungen des Autors 1862 im Salzkammergut wegen der Arten »Rheinankel«, »Kröpfling« und »Riedling«: nur am Attersee werden die aufgeblähten Coregonen »Kröpfling« genannt, an den anderen Seen werden diese kleinen Coregonen »Riedling« genannt. ) <br />
| |
| − | 3. Kilch →'' [https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/siebold_suesswasserfische_1863/?hl=Coregonen;p=267 (Coreg. hiemalis)]'' Kropf-Felchen; Kröpfling (?) <br />
| |
| − | 4. Schnäpel → ''[https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/siebold_suesswasserfische_1863/?hl=Coregonen;p=272 (Coreg. Oxyrhynchus)]''; (Meeresfisch, laicht im Süßwasser) <br />
| |
| − | 5. Große Maräne → ''[https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/siebold_suesswasserfische_1863/?hl=Coregonen&p=276 (Coreg. Maraena)]'' (Norddeutschland) <br />
| |
| − | 6. Kleine Maräne → ''[https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/siebold_suesswasserfische_1863/?hl=Coregonen&p=278 (Coreg Albula)]''
| |
| | | | |
| − | Interview Barbara Ritterbusch Nauwerck (2019): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_72_0116-0118.pdf Die Berufsfischerei am '''Mondsee im 20. Jahrhundert''' – Zeitzeugen berichten: '''Wolfgang Abel''' Teil 1]'' (1905–1997; Berufsfischer und Univ.-Prof. der Botanik und Zoologie an Univ. Hamburg) – Österreichs Fischerei 2019:116–118.
| + | ==Die häufigen Wasservögel am Attersee== |
| | | | |
| − | Interview Barbara Ritterbusch Nauwerck (2019): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_72_0152-0158.pdf Die Berufsfischerei am '''Mondsee im 20. Jahrhundert''' – Zeitzeugen berichten: '''Wolfgang Abel''' Teil 2]'' – Österreichs Fischerei 2019:152–158.
| + | Aubrecht 2003, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0124-0125.pdf Höckerschwan]'' – Denisia – 0007:124-125. |
| | | | |
| − | Interview Ritterbusch Nauwerck 2019, Barbara: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_72_0190-0198.pdf Die Berufsfischerei am '''Mondsee im 20. Jahrhundert''' – Zeitzeugen berichten: '''Wolfgang Abel''', Teil 3]'' Österreichs Fischerei 2019:190–198. <br /> (zum falschen Fischbesatz; zur unzureichenden Entschädigung für den Autobahnbau; zum tragischen Hinscheiden von Einsele; Besatz mit Maränen als Reinanken-Ersatz usw.)
| + | Aubrecht 2003, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0218-0219.pdf Lachmöve]'' Denisia – 0007:218-219. |
| | | | |
| − | Interview Ritterbusch Nauwerck 2017, Barbara: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_70_0305-0316.pdf Die Berufsfischerei am Mondsee im 20. Jahrhundert – Zeitzeugen berichten (Berufsfischer Hans Reichl: '''Blutalgen-Bericht''')]''. Österreichs Fischerei 2017:305–316.
| + | Aubrecht 2003, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0110-0111.pdf Haubentaucher]'' – Denisia – 0007:110-111. |
| | | | |
| − | Dollinger 2023, Peter: → ''[https://www.zootier-lexikon.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2872:felchen-maraenen-renken-reinanken-coregonus#taxo Felchenarten in Deutschland, Österreich und der Schweiz]'' (Berner Zoo; vgl. auflistende färbige Grafik)
| + | * Hemsen 1957, Jens: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_10_0139-0141.pdf Ist der Haubentaucher ein Fischereischädling?]'' – Österreichs Fischerei – 10:139–141. (sie fressen zu 2/3 größere Weißfische, zu 1/3 kleine Barsche; ein Tier frisst pro Jahr rd. 40 kg) |
| | | | |
| − | Hörnlein 2023, Jens: → ''[https://www.angelstunde.de/renken/ Renken, Felchen oder Maränen, die verschiedenen Arten]''
| + | Schuster 2003, Alexander: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0202-0203.pdf Blässhuhn]'' – Denisia 0007:202–203. |
| | | | |
| − | Einsele 1959, Wilhelm: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_12_5-6_0055-0087.pdf Das Bundesinstitut für Gewässerforschung und Fischereiwirtschaft in Scharfling am Mondsee - Arbeit und Aufgaben.]'' – Österreichs Fischerei – 12_5-6: 55 - 87.
| + | Müller 1979, Günther, Otto Moog (1979): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/EGRETTA_22_1_0001-0003.pdf Nahrung und Verteilung des Bläßhuhns am Mondsee.]'' – Egretta 1979:1-3. |
| | | | |
| − | * S. 69 f.: "Die '''''Laichzeit der Renkenvölker in den verschiedenen Salzkammergutseen''''' allein erstreckt sich über eine weite Zeitperiode. Sie beginnt im Hallstätter See und Traunsee in der zweiten Novemberhälfte (beendet ist sie hier um den 10. Dezember), dann laichen die Renken des Mattseegebietes und wenn diese geendet haben, so schickt sich die Kleine Schwebrenke des Attersees an, zu laichen. (Beginn der Laichzeit 18.—25. Dezember.) Ihr folgt um Neujahr die Renke des Wolfgangse;es und kurz darauf diejenige des Mondsees, deren Laichzeit fast den ganzen Januar über andauert. Ganz zum Schluß folgt die Große Schwebrenke des Attersees. Ihre Hauptlaichzeit fällt in den Februar, doch findet man regelmäßig auch in der ersten Märzhälfte laichende Paare."
| + | Aubrecht 2003, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0144-0145.pdf Stockente]'', Denisia 0007:144–145. |
| | | | |
| − | Landesfischereiverband OÖ: → ''[https://www.lfvooe.at/informationen/fragen-antworten/allgemeine-fragen-zur-fischerei/wo-finde-ich-informationen-zu-den-aktuellen-schonzeiten/ Schonzeiten: Reinanke oder Maräne]'': 16.10.–31.12.
| + | Aubrecht 2003, Gerhard: → [https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0152-0153.pdf Tafelente] Denisia – 0007:152-153. |
| | | | |
| − | Landesfischereiverband Salzburg: → ''[http://www.fischereiverband.at/Schonbestimmungen Schonzeiten Maränen (Coregonus lavaretus) und Renken (Coregonus sp.)]'': 1.11.-31.12.
| + | Aubrecht 2003, Gerhard: → [https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0154-0155.pdf Reiherente] Denisia – 0007:154-155. |
| | | | |
| − | Anm.: Der Fang der '''''Kröpflinge''''' sollte wegen Tierquälerei überhaupt verboten werden: Wenn sie aus ihrer großen Tiefe an die Wasseroberfläche gezogen werden, sterben sie am sogenannten „Barotrauma“, das auch „Trommelsucht“ heißt. Der plötzliche Druckabfall – von 7 1/2 bar auf 1 bar – sorgt dafür, dass ihre Schwimmblase sich aufbläht und platzt. Daher kommt auch ihr Name „Kropf-Felchen“ oder kurz „Kröpfling“ (Fisch mit einem Kropf). Der Kilch des Ammersees muss übrigens zarter gebaut sein, als der Kilch des Bodensees, da bei ersterem der ausgedehnte Bauch, sowie der Fisch aus dem Wasser gehoben wird, gewöhnlich mit einem Knall berstet.
| + | ---- |
| | | | |
| − | ====Zur Maräne und ihre Hybriden mit heimischen Renken====
| + | Aubrecht 1978, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_2_1978_0128-0136.pdf Ergebnisse von drei Wasservogelzählungen am Attersee im Winter 1977]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 2_1978:128-136. |
| | | | |
| − | [[Datei: Maräne.png|thumb|300px| ]] | + | Aubrecht 1979, Gerhard; Gert Michael Steiner: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_3_1979_0253-0261.pdf Wasservögel und Makrophyten am Attersee]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 3_1979:253-261. |
| | | | |
| − | [[Datei:Renken—Hybriden—Maränen.gif|thumb|300px|Renken—Hybriden—Maränen in Österreichs Seen <br /> Wert auf Ordinate: 1 = heimische Renken; wenn Wert: 0 = Maräne; Werte dazwischen = Hybriden]] | + | Winkler 1984, Hans; Gerhard Aubrecht: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/EGRETTA_27_1_0023-0030.pdf Zusammenhänge zwischen überwinternden Wasservögeln und die Beschaffenheit der Uferzone des Attersees]''. – Egretta – 27_1:23-30. |
| | | | |
| − | "Die nicht-einheimische Coregonus maraena Bloch (1779), umgangssprachlicher Name 'Maräne', wurde Anfang der 1950er Jahre in die österreichische Teichwirtschaft eingeführt und werden seither jährlich in vielen österreichischen Seen eingesetzt. Diese Fische stammen aus dem polnischen Miedwie-See (deutsch Madü-See) und wurden Ende des neunzehnten Jahrhunderts in der tschechischen Teichwirtschaft als Zuchtstamm mit hohem wirtschaftlichem Wert etabliert (Šusta, 1898; IUCN, 1997).“
| + | Aubrecht 1979, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/JOM_124a_0193-0238.pdf Die Wasservögel des Attersees 1977 und 1978 - Diskussion der Ursachen für die zeitliche und räumliche Verteilung]''. – Jahrbuch OÖMV – 124a:193-238. |
| | | | |
| − | Winkler 2010, Kathrin; Pamminger-Lahnsteiner, B.; Wanzenböck, J.; Weiss, St.: → ''[https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-294X.2010.04961.x Hybridization and restricted gene flow between native and introduced stocks of Alpine whitefish (Coregonus sp.) across multiple environments.]'' ''[Hybridisierung und Genfluss zw. einheimischen Renken und eingeführten Maränen in unterschiedlichem Umfeld]'' Molecular Ecology Volume 20, Issue 3 p. 456-472.
| + | Aubrecht 1981, Gerhard; Otto Moog: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_5_1981_0166-0174.pdf Die Entwicklung des Wasservogelbestandes im Attersee von Winter 78/79 bis Winter 80/81.]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 5_1981: 166 - 174. |
| | | | |
| − | Die Anteile der einzelnen Arten Renken, Hybriden und Maränen in den einzelnen Seen sind der nebenstehenden Grafik zu entnehmen. Die Abkürzungen der einzelnen Seen sind nachstehend angeführt. <br /> ACH … Achensee; FUS … '''''Fuschlsee'''''; HAL … Hallstättersee; KLO … Klopeinersee; KOP … Koppentraun; MIL … '''''Millstättersee'''''; MON … '''''Mondsee'''''; NIE … '''''Niedertrumersee'''''; OBE … '''''Obertrumersee'''''; WAL … '''''Waldviertel'''''; WOE … '''''Wörthersee'''''; WOL … Wolfgangsee; ZEL … '''''Zellersee'''''
| + | Aubrecht 1982, Gerhard; Otto Moog: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_6_1982_0179-0182.pdf Der Wasservogelbestand des Winterhalbjahres 1981/1982 am Attersee]''. – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 6_1982: 179 - 182. |
| | | | |
| − | <u>Schlussfolgerungen:</u> Unsere Untersuchung von acht Mikrosatelliten-Loci, zwei verketteten mtDNA-Segmenten und verschiedenen morphologischen Merkmalen bei Coregonus sp. aus österreichischen Seen gab Aufschluss über das Ausmaß der Hybridisierung und der Einkreuzung zwischen der heimischen und einer eingeführten baltischen Linie sowie über die genetische Struktur der heimischen Populationen. Es gelang uns, diese beiden Hauptlinien und ihre entsprechenden Hybriden zu identifizieren, wenngleich das Muster der Populationsstruktur von See zu See sehr unterschiedlich war. Wir konnten unterschiedliche Grade der Hybridisierung und Einkreuzung feststellen und vermuten bei den unterschiedlichen Ergebnissen der Einkreuzung '''''historische Umweltzerstörung''''' sowie andere ökologische Faktoren wie '''''un-/gleichzeitige Laichzeiten'''''. Die Identifizierung der einheimischen Populationen und des Ausmaßes der genetischen Auswirkungen der Einführung fremder Bestände ist für wirksame Schutz- und Bewirtschaftungsstrategien in der Region unerlässlich. Wir fordern die Verantwortlichen nachdrücklich auf, die verbleibenden einheimischen Genpools vor einer weiteren Verbreitung nicht-einheimischer Linien zu schützen.
| + | ==Die Wasserpflanzen des Attersees== |
| | | | |
| − | ====Weitere Untersuchungen====
| + | [[Datei: Attersee Unter Wasser.jpg|thumb|180px|]] |
| | | | |
| − | * Pamminger-Lahnsteiner 2009, B; Weiss, S.; Winkler, K.; Wanzenböck, J.: → ''[https://www.uibk.ac.at/limno/files/pdf/pamminger-lahnsteiner2009_article_compositionofnativeandintroduc.pdf Composition of '''native and introduced mtDNA lineages in Coregonus sp.''' in two Austrian lakes: evidence for spatio-temporal segregation of larvae?]'' Hydrobiologia (2009) 632:167–175. [Maräne – baltische Herkunft; Traunsee, Hallstättersee]
| + | OÖ Landesregierung: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/GWS-Ber_79_0001-0192.pdf '''<u>Phytoplankton</u>''' im Attersee 2013]''. Attersee S. 10–39. |
| | | | |
| − | * Pamminger-Lahnsteiner 2010, Barbara et al.: → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_63_0300-0311.pdf Verschwinden unsere heimischen Reinanken im Mondsee durch den Besatz mit Maränen?]''''' Österreichs Fischerei, 2010:300–311.
| + | Pall 2010, Karin et al.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/GUTNAT_0685_0001-0038.pdf '''<u>Makrophyten</u>'''kartierung Attersee – Bewertung nach WRRL]''. OÖ Landesregierung 2010, 38 Seiten. |
| − | ** Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Besatz mit Maränen nicht zum Verschwinden der ursprünglich vorkommenden (autochthonen) Reinanken geführt hat. Es existieren beide Gruppen im See nebeneinander, und der Genfluss zwischen diesen Gruppen ist deutlich eingeschränkt. Es ist (zumindest bis heute) zu keiner völligen Vermischung dieser beiden Formen gekommen. Andererseits deuten die Ergebnisse auf das Vorhandensein von Mischlingen (Hybride) hin. Daher raten die Autoren dem Fischereimanagement des Mondsees, den Schutz bzw. die Stärkung des natürlichen Reinankenbestandes zu forcieren. Der Laichfischfang im Jänner sollte in größerem Umfang durchgeführt werden und jener auf die Maräne hintangehalten werden
| |
| | | | |
| − | * Ritterbusch-Nauwerck 2005, B. & F. Lahnsteiner: → ''Effects of stocking on morphological and meristic characteristics on native coregonid populations in four Austrian lakes''. Zeitschrift für Fischkunde 7(2): 101–111. | + | * '''''Makrophyten''''' sind Gewächse, die mit bloßem Auge sichtbar sind. Diese umfassen die höheren Wasserpflanzen und die Armleuchteralgen. Zu den Wasserpflanzen werden nur die aquatischen Makrophyten, also die untergetaucht lebenden gezählt. |
| | | | |
| − | * Lusk 2010, Stanislav; Lusková, Vera; Hanel Lubomir: → [https://bioone.org/journals/folia-zoologica/volume-59/issue-1/fozo.v59.i1.a9.2010/Alien-fish-species-in-the-Czech-Republic-and-their-impact/10.25225/fozo.v59.i1.a9.2010.full Alien fish species in the Czech Republic and their impact on the native fish fauna.] Folia Zoologica, Volume 59, Issue 1; p. 57–72. | + | * Pall 2010, Karin et al.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/GUTNAT_0683_0001-0123.pdf Makrophytenkartierung Attersee.]'' OÖ Landesregierung 2010, 124 Seiten. (Die Wasserpflanzen des Attersees; alle Orte) |
| − | ** "In der Tschechischen Republik fand eine umfangreiche Hybridisierung zwischen Coregonus maraena und Coregonus peled statt, was zu einer deutlich verringerten Fitness der Hybriden führte, verbunden mit einer hohen Sterblichkeitsrate sowohl bei den Jungtieren als auch bei den ausgewachsenen Tieren."
| |
| | | | |
| − | * U.S. Fish & Wildlife Service: → ''[https://www.fws.gov/sites/default/files/documents/Ecological-Risk-Screening-Summary-Maraena-Whitefish_0.pdf Maraena Whitefish (Coregonus maraena); 14 p.]'', In: U.S. Fish & Wildlife Service 2021: Overall Risk Assessment Category: '''''Uncertain.'''''
| + | Jersabek 2021, Christian: → ''[https://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Dokumente%20UWD%20Abt_WW/Phytoplankton-Bericht%20O%C3%96%20GZ%C3%9CV%202020.pdf Ökologischer Zustand der Seen im Land OÖ]''; 198 Seiten. (Attersee-Phytoplankton; vorkommende Arten; Anzahl; OFFEN: Bilder) |
| | | | |
| − | * Eschmeyer´s Catalog of Fishes: → ''[https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp Search for „Maraena“]''; 6. November 2023. [Älteste Meldungen]
| + | Findenegg 1959, Ingo: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_12_5-6_0032-0035.pdf Das pflanzliche Plankton der Salzkammergutseen]'' – Österreichs Fischerei – 12:32–35 |
| | | | |
| − | ====Große Unterschiede zwischen Renken und den Maränen==== | + | ==Schifffahrt am Attersee OFFEN== |
| | | | |
| − | [[Datei: Morphometrische Renkeneigenschaften.png|thumb|340px| Morphometrische Unterschiede zw. Renken und Maränen]]
| + | ==Segelparadies Attersee OFFEN== |
| | | | |
| − | "Von allen Völkern der österreichischen Alpenseen laicht die Traunseer Reinanke am frühesten: Beginn zweite Novemberhälfte. Ihr folgt die Reinanke des Hallstättersees, mit der sie in anatomischer und biologischer Beziehung weitgehend übereinstimmt. An das Reinankenvolk des Traunsees schließen sich die im Gebiet der Trumerseen lebenden Renken an. Um den 20. Dezember herum beginnt dann die Laichzeit der Kleinen Schwebrenke des Attersees und mit der Jahreswende diejenige der Großen Schwebrenke des Mondsees und des Wolfgangsees. Der Mondsee gehört zu den Seen, die verhältnismäßig häufig zufrieren. In strengeren Wintern jedenfalls passiert es nicht selten, daß der See zufriert, während die Laichzeit in vollem Gange ist; das gleiche gilt für den Wolfgangsee. <br />
| + | ==Tauchparadies Attersee== |
| − | Die Große Schwebrenke des Attersees hingegen beginnt erst in der zweiten Jännerhälfte mit der Fortpflanzung. Während in der Regel die Fortpflanzungszeit bei den einzelnen Renkenvölkern zwei bis drei Wochen dauert, zieht sie sich bei der Großen Schwebrenke des Attersees, der selten zufriert, bis in den März hinein. Die Große Schwebrenke des Attersees ist der am spätesten laichende Schlag. Insgesamt dauert somit die Laichzeit der Reinankenvölker der österreichischen Alpenseen von Mitte November bis Mitte März." <br /> ('''''Einsele 1955''''', W.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_8_0031-0032.pdf Einige Beobachtungen während der Laichzeit der Reinanken (Renken) in österreichischen Seen]''. Österreichs Fischerei 8, 3/4: 31–32.)
| |
| | | | |
| − | ===(Ober-) Österreichs Fischfauna===
| + | Hois 2014, Harald, Kapfer Gerald: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0033_0009-0032.pdf Unterwasser - ein fotografischer Streifzug durch Seen, Flüsse und Bäche entlang der Ostalpen.]'' Zs. Denisia Bd. 33:9–32. (schöne Unterwasser-Bilder) |
| | | | |
| − | Siebold 1863, Carl Theodor Ernst von (1804 - 1885; Professor für Zoologie an Univ. Erlangen): → ''[https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/siebold_suesswasserfische_1863?p=78 Die Süsswasserfische von Mitteleuropa]''. Leipzig, 1863; 448 Seiten.
| + | Der Attersee gilt als Tauchmekka im Salzkammergut sowie im deutschsprachigen Raum. Der See gilt als das vielfältigste Tauchgewässer Österreichs und zählt zu den besten Süßwasser-Destinationen weltweit. Die Auswahl an Foto-Standorten richtet sich ganz nach den Wünschen der Fotografen: von der Architektur der Unterwasserkuppeln, Anlegestellen und Bootshäuser hin bis zu senkrecht abfallenden Steilwänden oder auch zu opulent bewachsenen Abhängen und Uferzonen reicht das Spektrum. Doch damit noch nicht genug: Schwarmphänomene wie der jährliche Laichzug der bis zu 1 m großen Perlfische (Abb. 27) oder die Millionen an Seelauben (Abb. 28) an den Hinkelsteinen sowie an weiteren Bachmündungen machen den Attersee einzigartig. |
| | | | |
| − | Spindler 1996, Thomas: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_49_0246-0261.pdf Zur Kenntnis des Fischartenspektrums Österreichs]'' – Österreichs Fischerei – 49:246–261. (ausgezeichneter Überblick zu Herkunft und Verbreitung aller ursprünglichen und heutigen Fischarten)
| + | ==Wasser und dessen außergewöhnlichen physikalischen Eigenschaften== |
| | | | |
| − | OÖ Landesfischereiverband: → ''[https://www.lfvooe.at/fischarten/ Heimische Fischarten.]'' (je Fisch: Abbildung; wesentliche Merkmale; Lebensräume; Nahrung; Größe)
| + | ===Das Wasser der Erde=== |
| | | | |
| − | Jungwirth 2002, Günther (BOKU Wien): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/nat-land_2002_1-2_0014-0026.pdf Österreichs Fischfauna]''. Natur und Land 2002:14–26. (HQ: Besatz; Biologie; Gefährdung; See-Arten)
| + | Die Erde besitzt insgesamt 35 Milliarden km³ Wasser und bedeckt damit 71 % der Erdoberfläche – das sind 520 Millionen km². |
| | | | |
| − | Mikschi 2007, Ernst; Wolfram, Georg: ''[https://www.dws-hydro-oekologie.at/wp-content/uploads/wolfram_mikschi_2007_rotelistefische.pdf Rote Liste der Fische (Pisces) Österreichs.]'' BMLFUW 2007. 138 Seiten. (detaillierte Darstellungen zu: Seesaibling (S. 67); Bachforelle / Seeforelle (S. 68); Attersee-Rainanke / Kröpfling (S. 71–77); sowie Bewertung der Gefährdung aller österr. Fische)
| + | Davon gibt es nur 24,3 Millionen km³ (= 0,7 ‰) in Form von Eis (Polareis, Gletscher, Schnee, Permafrost) und 10,5 Millionen km³ als Grundwasser. Nur 122.000 km³ sind in Süßwasserseen, Bodenfeuchte, Mooren/Sümpfen und Flüssen enthalten. Die Atmosphäre trägt 12.900 km³ Wasser. |
| | | | |
| − | Spindler 1997, Thomas: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/UBA_M-087_0001-0141.pdf Fischfauna in Österreich. Ökologie - Gefährdung - Bioindikation - Fischerei - Gesetzgebung.]'' – Publikationen des UBA, Wien – M-087:1-141. Anhang – '''''Phototeil''''' S. 142–151: 74 BILDER; Lebensräume S. 151–157.
| + | Es lässt sich ermitteln, dass durch das Abschmelzen des Grönlandeises der Weltmeeresspiegel um rd. 6 m ansteigen würde. Unter der Annahme, dass alle Eismassen der Erde abschmelzen würden, stiege der Spiegel des Weltmeers um rd. 47 m an. (Anm.: Da der Meeresspiegel zum Höhepunkt der letzten Eiszeit um 120 m tiefer als heute lag, kann man schließen, dass damals gegenüber heute mehr als drei Mal so viel Wasser als Eis gebunden war.) |
| | | | |
| − | Lahnsteiner 2003, Franz; Albert Jagsch, Paul Jäger (2003): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_56_0298-0306.pdf Unterschiede im '''Phänotyp von Bachforellen und Seeforellen''' aus rezenten Wildpopulationen, aus Wildpopulationen des 19. Jahrhunderts und aus Zuchten]'' – Österreichs Fischerei – 56:298–306.
| + | ===Dipol-Eigenschaft von Wassermolekülen=== |
| | | | |
| − | Kolowrat-Krakowsky 1976, Christoph: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_29_0083-0085.pdf Ist die echte Bachforelle in unseren Gewässern langsam zum Aussterben verurteilt?]'' – Österreichs Fischerei – 29:83–85.
| + | Wassermoleküle bestehen aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom (H<sub>2</sub>O). Da die Wassersstoffatome bei der Elektronenpaarbindung ihre Elektronen an das Sauerstoffatom abgeben, zeigen sie elektrisch eine positive Ladung und das Sauerstoffatom eine doppelte negative Ladung. |
| | | | |
| − | Schwomma 1989, Otto: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_42_0087-0096.pdf Der Einfluß des Mindestmaßes der Bachforelle auf Bestand und Angelertrag]'' – Österreichs Fischerei – 42:87–96.
| + | Da sich die positiv geladenen Wasserstoffatome seitlich in einem Winkel von 104,5° an das negativ geladene Sauerstoffatom anlagern – und nicht entlang einer geraden Linie – wirkt das Wassermolekül elektrisch als ein Dipol. |
| | | | |
| − | Honsig-Erlenburg 2005, Wolfgang: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_58_0286-0289.pdf Zum Einfluss der Regenbogenforelle und des Bachsaiblings auf Bachforellenpopulationen]'' – Österreichs Fischerei – 58:286–289.
| + | ===Wasserstoffbrücken durch Dipol-Dipol-Wechselwirkungen=== |
| | | | |
| − | Johannes Hager (2008): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_61_0130-0142.pdf Der heimische Seesaibling in der Speisefischzucht: Probleme - Lösungsansätze - erste Ergebnisse]'' – Österreichs Fischerei – 61:130–142.
| + | [[Datei: Wasserstoffbrücken.png|thumb|340px|Wasserstoffbrücken durch Dipol-Dipol-Wechselwirkungen]] |
| | | | |
| − | Kainz 2010, Erich: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_63_0031-0034.pdf Zum Vorkommen einiger mehr oder weniger stark bedrohter Fischarten in Österreich. '''Elritze''' (Phoxinus phoxinus)]'' – Österreichs Fischerei – 63:31–34.
| + | Die Wassermoleküle richten sich nun so aus, dass die Plus- und die Minus-Teilladungen zueinander zeigen und damit die einzelnen Wassermoleküle durch die elektrischen Anziehungskräfte stark aneinander gebunden werden. Jedes elektropositive Wasserstoffatom eines Wassermoleküls versucht, möglichst in der Nähe eines elektronegativen Sauerstoffatoms eines anderen Moleküls zu sein (das sind die sogenannten "Wasserstoffbrücken"; vgl. die obige Abbildung). |
| | | | |
| − | Hauer 1997, Wolfgang: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_50_0174.pdf Elritze bzw. Pfrille Gefährdungsstatus: (A.4) gebietsweise potentiell gefährdet]'' – Österreichs Fischerei – 50:174.
| + | Diese Wasserstoffbrückenbildung führt zu Clustern von Wassermolekülen. Je niedriger die Temperatur des Wassers, umso mehr lagern sich die Moleküle aneinander, je höher die Temperatur umso weniger Brücken gibt es. |
| | | | |
| − | Hochleithner 1989, Martin: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_42_0015-0021.pdf Die Situation der Seeforelle (Salmo trutta f lacustris L.) in österreichischen Seen]'' – Österreichs Fischerei – 42:15–21. (Attersee; Besatz mit reinen heimischen Seeforellen)
| + | ===Auswirkungen der Wasserstoffbrücken=== |
| | | | |
| − | Petz-Glechner 2007, Regina; Wolfgang Petz, Stefan Achleitner: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_60_0052-0062.pdf Fischökologische Charakterisierung von Seeausrinnen einiger österreichischer und bayerischer Seen]'' – Österreichs Fischerei – 60:52–62. (Attersee – Ager, Mondsee –Seeache, Irrsee – Zeller Ache, Wolfgangsee – Ischl, Traunsee – Traun, Wallersee – Fischach, Trumer Seen – Mattig, Fuschlsee – Fuschler Ache; Starnberger See – Würm, Chiemsee – Alz, Ammersee – Amper)
| + | [[Datei: oberflaechenspannung.jpg|thumb|300px|Oberflächenspannung wegen Wasserstoffbrücken]] |
| | | | |
| − | ===Interessantes===
| + | Wie der nebenstehenden Grafik entnommen werden kann, heben sich die elektrischen Anziehungskräfte im Wasserinneren auf. Demgegenüber bildet sich an der Wasseroberfläche eine Schicht, bei der die Wassermoleküle für die (positiv geladenen) Wasserstoffatome keine Kompensation mehr finden und es bildet sich eine durch elektrische Kräfte gebildete Oberflächenspannung. |
| | | | |
| − | Link zum → ''[https://www.sab.at/gewaesser/sab-gewaesser/attersee.html Sportanglerbund Vöcklabruck]'' - UND: → ''[https://www.sab.at/gewaesser/sab-gewaesser/attersee/fischereiwirtschaft-attersee.html Geschichte der Fischereiwirtschaft am Attersee]''
| + | ====Glückhafte – überhaupt Leben ermöglichende – Aggregatzustände==== |
| | | | |
| − | Wertungen in der → ''[https://www.sab.at/gewaesser/wissenswert/fischarten.html Fischschautafel des Sportanglerbundes Vöcklabruck.]'' (in Arbeit)
| + | Ohne diesen Dipolcharakter und die dadurch hervorgerufenen Wasserstoffbrücken, die die einzelnen Moleküle stärker aneinander binden, wäre Wasser bei normalen Temperaturen keine Flüssigkeit sondern längst verdampft. Wasser hätte seinen '''''Schmelzpunkt bei –100 °C und den Siedepunkt bei –80 °C'''''. |
| | | | |
| − | Pachinger 1966, August: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_19_0003-0006.pdf Das Räuchern von Fischen]'' – Österreichs Fischerei – 19:3–6.
| + | Dann gäbe gäbe es aber kein Leben auf der Erde. |
| | | | |
| − | Oberösterreich: → ''[https://www.oberoesterreich.at/rezepte/fischrezepte.html 15 Fischrezepte aus Oberösterreich]''
| + | ====Bildung von Wassertropfen und Regen==== |
| | | | |
| − | Ferihumer 1956, Heinrich: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_9_0045-0048.pdf Fischerkanzeln]'' – Österreichs Fischerei – 9:45–48.
| + | Der obigen Grafik ist auch einfach zu entnehmen, dass sich bei ersten gebildeten kleinen Tropfen z.B. in einer Wolke an der Oberfläche eine positive elektrische Anziehungskraft der Wasserstoffatome für elektrisch negativ geladene Wasser-Sauerstoffatome in deren Nähe besteht und sich diese Wassermoleküle gerne an bestehende Wassertropfen angliedern - und damit das Wachsen von Regentropfen bewirken. Ohne diese Oberflächenspannung gäbe es keinen Regen, da sich keine größeren Wassertropfen bilden würden, deren Gewicht die Voraussetzung für Regen sind. |
| | | | |
| − | Schaber 1985, P.: → [https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_38_0057-0064.pdf Das Nährstoffpotential des Zooplanktons in österreichischen Gewässern] – Österreichs Fischerei – 38:57–64. (S. 63: '''''im Attersee bis 60 m Tiefe 26.000 t Zooplanktonfrischmasse pro Jahr''''')
| + | [[Datei: Wasserläufer.png|thumb|150px|Oberflächenspannung]] |
| | | | |
| − | Herzig 1985, Alois: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_38_0097-0108.pdf Fischnährtier-Almanach für den Mondsee]'' – Österreichs Fischerei – 38:97–108. (Jahresgang Phyto- und Zooplanktonarten samt Abbildung; Verhältnis Phyto- zu Zooplankton: Vergleich mit Attersee; Wassertiefe; Tageswanderung; Bodentiere)
| + | ===="Wasserläufer" sinken nicht ein==== |
| | | | |
| − | Moog 2002, Otto: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/nat-land_2002_1-2_0010-0013.pdf Zu Tisch beim Fisch - Fischnährtiere - '''womit Fische sich verköstigen.'''''] – Natur und Land 2002:10–13.
| + | Wie in der Abbildung zu sehen ist, nutzen „Wasserläufer“ diese Oberflächenspannung, sodass sie über das Wasser laufen können ohne einzusinken. Zusätzlich haben sie Luftpolster an ihren Füßen, die ihnen zusätzlichen Auftrieb verleihen. |
| | | | |
| − | Herzig 1985, Alois et al.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_38_0182-0196.pdf Der Einfluß der Temperatur auf die embryonale Entwicklung der Cypriniden]'' – Österreichs Fischerei – 38:182-196. (alle Arten der Weißfische, karpfenartigen Fische)
| + | ===Dichte-Anomalie des flüssigen Wassers=== |
| | | | |
| − | Gihr 1958, Margarete: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_11_0109-0115.pdf Vom Hecht-Ei zum Vollhecht]''. – Österreichs Fischerei – 11:109–115. (tolle Abbildungen)
| + | [[Datei: dichteanomalie flüssiges Wasser.jpg|thumb|260px| Dichteanomalie des flüssigen Wassers]] |
| − | | |
| − | Hemsen 1964, Jens: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_17_0180-0183.pdf Die Einbürgerung amerikanischer Salmoniden, insbesondere der Regebogenforellen im vorigen Jahrhundert]'' – Österreichs Fischerei – 17:180–183. (viele Versuche, Historie)
| |
| − | | |
| − | Heinz Benda (1963): → ''[https://www.zobodat.at/biografien/Koettl_Hanns_Forellenzuchtstation_Oesterreichs-Fischerei_16_0163-0169.pdf Vor 100 Jahren wurde in Neukirchen a. d. Vödkla die erste Forellenzuchtanstalt in der ehemaligen österr.- ungarischen Monarchie durch Hanns Köttl begründet]'' – Österreichs Fischerei – 16:163–169.
| |
| − | | |
| − | von Brandt 1958, Andres: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_11_0033-0040.pdf Aalfang in Seen]'' – Österreichs Fischerei – 11:33–40. (Fangmethoden, viele Abbildungen)
| |
| − | | |
| − | Hemsen 1959, Jens: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_12_0033-0039.pdf Die Schwimmblase der Fische - mannigfaltig im Bau - vielseitig in der Funktion]'' – Österreichs Fischerei – 12:33–39.
| |
| − | | |
| − | Pohla 1986, H. et al: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_39_0094-0104.pdf Der Kiemenreusenapparat europäischer Karpfenfisch-Arten (Teleostei, Cyprinidae).]'' Österreichs Fischerei, 1986:94–104. (TOLLE elektronenmikroskopische Aufnahmen der Kiemenreusen; Seelaube…)
| |
| − | | |
| − | Danecker 1961, Elisabeth: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_14_0073-0077.pdf Die Libellen - das glänzende, streitbare Volk über Wasser und Schilf]'' – Österreichs Fischerei – 14:73–77.
| |
| − | | |
| − | von Frisch 1962, Karl: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_15_0077-0079.pdf Insekten - die Herren der Erde]'' – Österreichs Fischerei – 15: 77–79.
| |
| − | | |
| − | Haempel 1951, Oskar: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_4_0149-0150.pdf <u>Giftige Fische</u>.]'' Österreichs Fischerei 1951, S. 149–150. (giftiges Aalblut (auf 60 °C erhitzen hebt Wirkung auf); Thunfisch-Blut; Wels-Blut; der rohe Rogen der Barbe)
| |
| − | | |
| − | Aubrecht 1983, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/JOM_128a1_0215-0227.pdf Fische.]'' (14 Seiten Literaturzusammenstellung; 22 x „Attersee“)
| |
| − | | |
| − | Baumgartner 1955, Richard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_8_0130-0134.pdf Der Angelhaken einst und heute]'' – Österreichs Fischerei – 8:130–134. (von den Pfahlbauern bis heute)
| |
| − | | |
| − | Petz-Glechner 2007, Regina, Petz Wolfgang, Achleitner Stefan: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_60_0052-0062.pdf Fischökologische Charakterisierung von Seeausrinnen einiger österreichischer und bayerischer Seen.]'' Österreichs Fischerei 2007, S. 52–62. (Seeache: Wanderungen von Perlfisch und Seelaube, Ager: v.a. 54% Barbe, 11% Aitel, 25% Koppe)
| |
| − | | |
| − | Anonymous (1975): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_28_0088-0093.pdf Die letzte Trockenperiode des Neusiedler See 1865-1871]'' – Österreichs Fischerei – 28:88–93. (Austrocknungen: 1736, 1811, 1865-1871)
| |
| − | | |
| − | Manfred Rydlo (1970): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_23_0164-0165.pdf Windhose am Mondsee]'' – Österreichs Fischerei – 23:164–165. (Bild)
| |
| − | | |
| − | ===Älteste Erhebungen der Fischarten im Attersee===
| |
| − | | |
| − | ====Jakob Heckel (1790–1857)====
| |
| − | | |
| − | [[Datei: Jacob Heckel.png|thumb|175px| Jacob Heckel (1790–1857)]]
| |
| − | | |
| − | Johann Jacob Heckel → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_62_0285-0288.pdf Biographischer Abriss]''
| |
| − | | |
| − | Jakob Heckel (1850): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DAKW_1_1_0201-0242.pdf Beiträge zur Kenntnis der <u>fossilen Fische</u> Österreichs - Abhandlung I.]''. Denkschr. Akad. d. Wiss. Wien 1850, S. 201-242; mit 13 Bild-Tafeln. Abbildungen auf den Seiten 43-59. ('''97 MB''')
| |
| − | | |
| − | Jakob Heckel (1851) → ''[https://www.zobodat.at/pdf/SBAWW_07_0281-0333.pdf Bericht einer auf Kosten der kais. Akademie der Wissenschaften durch '''''Oberösterreich''''' nach Salzburg ... unternommenen Reise]''. Si.-Ber. AdW math.-naturw. Klasse, 1851, S. 281–333.
| |
| − | | |
| − | [[Datei: † Maiforelle.png|thumb|220px|'''<big>†</big> <u>Maiforelle</u>''' (wurde bis 70 cm lang)]]
| |
| − | | |
| − | * '''<u>Die Fische des Attersees um 1850</u>''': S. 285-293: Bericht des '''''Fischers Schmoller''''' von Schörfling: Huchen (Salmo Hucho Linn.) – kommt nur in Dürrer Ager bis St. Georgen vor. <u> <br /> '''22 Arten im Attersee'''</u>: Lachsforelle (Fario Marsilii Heck.); ''die heute ausgestorbene'' '''''<u> † Maiforelle</u> (Salar Schiffermülleri Valenc. → vgl. beigefügte Abbildung)'''''; Saiblinge (Salmo Salvelinus Lin.); Bachforelle (Salar Ausonii Valenc.); der Asch (Thymulus vexillifer Agass.) nahe dem Ausfluss; Rheinanken (Coregonus Wartmannii Cuv.); eng verwandt mit den kleineren Kröpflingen (Coregonus Fera Cuv.); Schied (Abramis Vimba Cuv.); Brachsen (Abramis Beama Cuv.); Perlfisch oder Weissfisch (Leuciscus Meidingeri Heck.); Döbel (Squalius Dobula Heck.) in zwei Arten; Bitterling (Rhodeus amarus Agass.); Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus Bonap.); Rothäugeln (Leuciscus rutilus Cuv.); Elritze (Phoxinus Marsilii Heck.), auch "Pfrillen"/"Frirln" genannt; Seelaube (Alburnus Mento Heck.); Barbe (Barbus fluviatilis Cuv.), Schmoller bestätigt den giftigen Rogen der Barben; Bartgrundel (Cobitis barbatula Lin.); Quappe (Lota communis Cuv.); Hecht (Esox Lucius), bis 48 Pfund schwer; Koppe (Cottus gobio Lin.); Schratz {Perca fluviatilis Lin.), auch: Flussbarsch (Anm.: wahrscheinlich verbuttet, da als Letzter genannt).
| |
| − | | |
| − | Jakob Heckel (1852): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/SBAWW_08_0347-0391.pdf Fortsetzung des im Julihefte 1851 enthaltenen Berichtes über eine, auf Kosten der kais. Akademie der Wissenschaften unternommene, ichtyologische Reise]''. Si.-Ber. AdW math.-naturw. Klasse, 1852, S. 347–391.
| |
| − | | |
| − | * Die Fischer an unseren größeren oberösterreichischen Seen bezeichnen die darin vorkommenden Coregonus-Arten mit drei verschiedenen Namen Rheinankel, Kröpfling und Rindling. In dem Attersee befinden sich Rheinankeln und Kröpflinge, welche die Fischer durch ihre Lebensweise und die Färbung ihrer Flossen unterscheiden. Erstere, die Rheinankeln, laichen im Februar und März nur in einer Tiefe von 10 Klaftern, haben schwarzblaue Flossen und werden bis 4 Pfund schwer. Letztere, die Kröpflinge, laichen im Dezember bei einer Tiefe von 40 Klaftern, haben beinahe farblose, röthlich-grüne Flossen und werden nur 1/2 Pfund schwer. In dem Gmundner oder Traunsee sind Rheinankeln und Rindlinge. ''(S. 376 zu den Coregonen - Rheinanken-Arten in den Salzkammergutseen.)''
| |
| − | | |
| − | Heckel , J. (1851): Über die in den Seen Oberösterreichs vorkommenden Fische. Sitz. Math.-nat. Klasse Kais. Akad. Wiss. Wien 6 (2), 145-149.
| |
| − | | |
| − | Jakob Heckel (1858) '''''& Rudolf Kner''''': → ''[https://www.zobodat.at/pdf/MON-V-FISCH_0001_0001-0388.pdf Die Süßwasserfische der österreichischen Monarchie]''. Monografien Vertebrata Pisces, 1858; 398 Seiten mit 204 Abbildungen. ('''31 MB''').
| |
| − | * Suchergebnisse: 22 Fische im Attersee; Suchen: "Atter" 36x; "Attersee" 14x, Traunsee 5x, Mondsee (Perlfisch) 1x, Traun 20x, Vöckla (S. 246!) 1x, Ager 1x, Donau 96x ((nach Fischer Schmoller; jeweils eine Abbildung; Barbe, Bitterling, Brachsen, (Blau-)Nase („Schied“), Rotauge, Perlfisch, Aitel, Schleie, Kröpfling, Äsche, Hecht, Aalrutte, Barsch, Seelaube, Seeforelle, Elritze, Koppe …)
| |
| − | | |
| − | ====Fitzinger Leopold (1802-1884)====
| |
| − | | |
| − | Fitzinger (1879) Leopold: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/SBAWW_78_0596-0602.pdf Bericht über die im Erlaph- und Lunzer-See vorkommenden Fischarten]''. Si,-Ber. AdW, math.-naturwiss. Kl., 1879, S. 597.
| |
| − | | |
| − | Aus dem '''''Kammer- oder Atter-See''''' habe ich nur 26 verschiedene Arten aus 6 natürlichen Familien kennen gelernt. <br /> Es sind dies folgende: Flussbarsch (Perca fluviatilis) und Zander (Lucioperca Sundra) aus der Familie der Barsche, — Hecht (Esox Lucius) aus der Familie der Hechte, — Äsche (Thymallus vexillifer), Reinanke (Coregonus Wartmanni), Kröpfling (Coregonus Fera), Seesaibling (Salmo Salvelinus, Var. Marsilii), Seeforelle (Trutta lacustris) nebst Var. Maiforelle (Schiffermülleri) und Seeforelle (Trutta Favio, Var. Lacustris) aus der Familie der Salme, — Barbe (Barbus fluviatilis(, Karpfen (Cyprinus Carpio), Bitterling (Rhodeus amarus), — Brachse (Abramis Brama) — Rußnase (Vimba Zerta) nebst Var. Schiedling (melanops), Laube (Alburnus lucidus), Seelaube (Alburnus Mento), Ukelei (Alburnus bipunctatus), Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus), Rotauge (Rutilus rutilus), Döbel (Cephalus Dobula), Perlfisch (Leuciscus Meidingeri) und Elritze (Phoxinus Marsilii) aus der Familie der Karpfen, — Schmerle (Barbatula vulgaris) und ? (Acanthops Taenia) aus der Familie der Schmerlen. — Groppe (Cottus Gobio) aus der Familie der Groppen — und Quappe (Lota vulgaris) aus der Familie der Schellfische.
| |
| − | | |
| − | ===Moderne Fischereiwirtschaft===
| |
| − | | |
| − | ====Oskar Haempel (1882–1953)====
| |
| − | | |
| − | Prof. Dr. O. Haempel zum → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_5_0097-0098.pdf 70. Geburtstag 1952]''
| |
| − | | |
| − | Haempel 1912, Oskar: → ''[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipkqy1uZOCAxW5g_0HHSOwBoAQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.forgottenbooks.com%2Fen%2Fdownload_pdf%2FLeitfaden_der_Biologie_der_Fische_1100144387.pdf&usg=AOvVaw1rROYIcKjAuBiQpRRP-wzh&opi=89978449 Leitfaden der Biologie der Fische.]'' Verlag F. Enke, Stuttgart. 188 Seiten. (allgemein zu „Fischen“)
| |
| − | | |
| − | Haempel 1915, Oskar: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/SVVNWK_55_0199-0229.pdf Das Tier- und Pflanzenleben unserer Alpenseen]''. Verein zur Verbreitung naturw. Kenntnisse. Wien 1915, S. 199-229. (eher Lebewesen, Pflanzen; weniger Fische)
| |
| − | | |
| − | Haempel (1926), Oskar: → ''[https://eurekamag.com/research/024/167/024167503.php Zur Kenntnis einiger Alpenseen. IV. Der Attersee]''; Intern. Rev. Hydrobiologie, Leipzig 1926.
| |
| − | | |
| − | * Volume 15, Issue 5-6, p. 273-322. → ''[https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/iroh.19260150502 Zur Kenntnis einiger Alpenseen. IV. Der Attersee.]'' → ''[[Literaturverzeichnis Haempel 1926|Literaturverzeichnis]]''
| |
| − | | |
| − | * Volume 16, Issue 3-4, p. 180-232. → ''[https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/iroh.19260160304 Zur Kenntnis einiger Alpenseen. IV. Der Attersee. Fortsetzung und Schluß.]''
| |
| − | | |
| − | Haempel 1930, Oskar: → ''[https://www.schweizerbart.de/publications/detail/isbn/9783510407101/Binnengewasser_Bd_10 Fischereibiologie der Alpenseen.]'' 1930. 259 Seiten, 28 Abb. 15 Tafeln. (29 €)
| |
| − | | |
| − | Haempel 1951, Oskar: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_4_0270-0272.pdf Probleme der Coregonen-Systematik in den Gewässern Mitteleuropas.]'' – Österreichs Fischerei – 4:270–272.
| |
| − | | |
| − | Haempel 1951, Oskar: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_4_0149-0150.pdf <u>Giftige Fische</u>.]'' Österreichs Fischerei 1951, S. 149–150.(giftiges Aalblut (auf 60 °C erhitzen hebt Wirkung auf); Thunfisch-Blut; Wels-Blut; der rohe Rogen der Barbe)
| |
| − | | |
| − | ===Der Intensiv-Fischbewirtschafter Wilhelm Einsele (1904-1966)===
| |
| − | | |
| − | † 17.12.1966: ''→ [https://www.zobodat.at/biografien/Einsele_Wilhelm_zum_100er_Oesterreichs-Fischerei_57_11-12-2.pdf "ist unter tragischen Umständen von uns gegangen"]'' → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_20_0001-0002.pdf Nachruf 1967]''
| |
| − | ''[Anm.: 1968 bis 1977 Einsele-Gedächtnisfischen am Wallersee]''
| |
| − | | |
| − | Einsele 1963, Wilhelm: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_16_0067.pdf Der Winter 1962/63, die Gewässer und die Fischerei.]'' – Österreichs Fischerei – 16:67.
| |
| − | | |
| − | Einsele 1963, Wilhelm: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_16_0068-0072.pdf Am 31. März 1963 ging das Eis im Attersee unter!]'' – Österreichs Fischerei – 16:68-72.
| |
| − | | |
| − | [[Datei: Fisckenhauser Einbaum 1959.png|thumb|300px| Fischenhauser (91 a alt) Fischerei-Einbaum 1959]]
| |
| − | | |
| − | Einsele 1959 , W. & Hemsen, J.: → [https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_12_5-6_0009-0031.pdf Über die Gewässer des Salzkammergutes, insbesondere über einige Seen]. Österr. Fischerei 1959 (5/6), S. 6-31. (Attersee S. 14–16; Fische S. 16 ff. im Attersee zwei unterschiedliche Reinanken-Arten. Saiblinge leben 5 m unter den Renken; S. 25: Fischerei-Einbaum am Mondsee 1959)
| |
| − | | |
| − | Einsele 1959, Wilhelm: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_12_5-6_0055-0087.pdf Das Bundesinstitut für Gewässerforschung und Fischereiwirtschaft in Scharfling am Mondsee - Arbeit und Aufgaben.]'' – Österreichs Fischerei 1959:55-87.
| |
| − | | |
| − | * Die '''''Laichzeit der Renkenvölker in den verschiedenen Salzkammergutseen''''' allein erstreckt sich über eine weite Zeitperiode. Sie beginnt im Hallstätter See und Traunsee in der zweiten Novemberhälfte (beendet ist sie hier um den 10. Dezember), dann laichen die Renken des Mattseegebietes und wenn diese geendet haben, so schickt sich die Kleine Schwebrenke des Attersees an, zu laichen. (Beginn der Laichzeit 18.—25. Dezember.) Ihr folgt um Neujahr die Renke des Wolfgangse;es und kurz darauf diejenige des Mondsees, deren Laichzeit fast den ganzen Januar über andauert. Ganz zum Schluß folgt die Große Schwebrenke des Attersees. Ihre Hauptlaichzeit fällt in den Februar, doch findet man regelmäßig auch in der ersten Märzhälfte laichende Paare.
| |
| − | | |
| − | Einsele 1958, Wilhelm: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_11_0115-0120.pdf Biotechnische Hinweise zur Frage der Erbrütung von Hechteiern und zur Frage des Transportes und Aussetzens von Hechtsetzlingen]'' – Österreichs Fischerei – 11:115–120.
| |
| − | | |
| − | Einsele 1956, Wilhelm: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_9_0025-0031.pdf Über das Endalter unserer Süßwasserfische.]'' Österreichs Fischerei 1956, S. 25–31. (Fische werden rund 10 Jahre alt; Störe bis 100 a)
| |
| − | | |
| − | Einsele 1955, W.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_8_0031-0032.pdf Einige Beobachtungen während der Laichzeit der Reinanken (Renken) in österreichischen Seen]''. Österreichs Fischerei 8, 3/4:31–32.
| |
| − | | |
| − | Einsele 1953, Wilhelm: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_6_0065-0068.pdf Die Fischerei als Beruf und als Liebhaberei.]'' – Österreichs Fischerei 1953:65-68.
| |
| − | | |
| − | * S. 67 f.: Betriebsordnung für die Sportfischerei am Attersee.
| |
| − | | |
| − | Eisenle 1952, Walter: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_5_0137-0140.pdf Die Fischzuchtanstalt Kreuzstein]'' – Österreichs Fischerei – 5:137–140.
| |
| − | | |
| − | Einsele 1950, Wilhelm: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_3_0181-0185.pdf Über den Sauerstoffbedarf von Fischen.]'' – Österreichs Fischerei – 3:181-185.
| |
| − | | |
| − | Eisenle 1945, W.: → ''[https://gepris-historisch.dfg.de/fall/108755? Steigerung der Fischereierträge unserer Seen auf ihr Höchstmaß]'' (Forschungsauftrag – Reichsforschungsrat )
| |
| − | | |
| − | Einsele 1944, W.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/JOM_91_0432-0436.pdf Berichte über wissenschaftliche Tätigkeit im Gau. Reichsanstalt für Fischerei.]'' JBOÖMV:432-436.
| |
| − | | |
| − | Einsele 1944, W.: → ''[https://gepris-historisch.dfg.de/fall/108754? Düngung von Seen und Massenzucht von Futtertieren zur Besatzfischaufzucht]'' (Sachbeihilfe – Reichsforschungsrat)
| |
| − | | |
| − | Einsele 1943, W.: → ''[https://gepris-historisch.dfg.de/fall/108752? Steigerung der Fischereierträge der Alpen- und Voralpenseen auf ihr Höchstmass]'' (Forschungsauftrag – Reichsforschungsrat)
| |
| − | | |
| − | Einsele 1943, W.: → ''[https://gepris-historisch.dfg.de/fall/108753? Düngung von Seen und Massenzucht von Futtertieren zur Besatzfischaufzucht]'' (Forschungsauftrag – Reichsforschungsrat)
| |
| − | | |
| − | Einsele 1942, W.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/JOM_90_0391-0392.pdf Berichte über wissenschaftliche Tätigkeit im Gau. Reichsanstalt für Fischerei.]'' JBOÖMV:391-392.
| |
| − | | |
| − | Einsele 1940, W.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/JOM_89_0331.pdf Berichte über wissenschaftliche Tätigkeit im Gau. Reichsanstalt für Fischerei.]'' JBOÖMV:331.
| |
| − | | |
| − | Einsele 1939, W.: → ''[https://www.zobodat.at/biografien/Einsele_Wilhelm_zum_100er_Oesterreichs-Fischerei_57_11-12-2.pdf Leiter der Reichsanstalt für Fischerei, Abteilung für Fischerei in Gebirgsgewässern in Weißenbach]''
| |
| − | | |
| − | Einsele 1934, W.: → ''[https://www.zobodat.at/biografien/Einsele_Wilhelm_zum_100er_Oesterreichs-Fischerei_57_11-12-2.pdf Institut für Seenforschung in Langenargen am Bodensee]'' (Arbeiten zum Mangan-, Eisen- und Phosphatkreislauf in Seen).
| |
| − | | |
| − | ===Fischbiologen und Fischerei-Wirtschafter===
| |
| − | | |
| − | ====Der Biologe Hubert Gassner (Scharfling)====
| |
| − | | |
| − | Gassner 2003, Hubert et al.: Die Fischartengemeinschaften der großen österreichischen Seen. Vergleich zwischen historischer und aktueller Situation; fischökologische Seentypen. Schriftenreihe des Bundesamtes für Wasserwirtschaft, Bd. 18:1–83.
| |
| − | | |
| − | Gassner 2004, Hubert; Wanzenböck, J. et al.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_57_0020-0027.pdf Die Veränderungen der Fischartengemeinschaften in den großen österreichischen Seen während der letzten 150 Jahre.]'' Österreichs Fischerei 2004:20–27.
| |
| − | | |
| − | * Die heutigen Fischgemeinschaften der österreichischen Naturseen unterschieden sich grundlegend von der Situation rund 150 Jahre vor der Gegenwart. Derzeit wurden 43 Fischarten (einheimische, umgesiedelte und gebietsfremde Arten) in den österreichischen Seen nachgewiesen, während es in der Vergangenheit nur 33 Fischarten waren (drei davon fehlen heute; Abb. 1). Neun der 13 neu nachgewiesenen Fischarten sind gebietsfremde Arten und zusätzlich vier umgesiedelte Fischarten neu in österreichischen Seen nachgewiesen.
| |
| − | | |
| − | Gassner 2016,Hubert, Stabbauer Veronika: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_69_0054-0064.pdf Anpassung von Längenfrequenz-Indizes an Barschbeständen (Perca fluviatilis L.) österreichischer Seen.]'' Österreichs Fischerei 2016:54–64 (VERBUTTUNG ?)
| |
| − | | |
| − | Gassner 2006, Hubert et al.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_59_0020-0027.pdf Auswirkung und Populationsentwicklung des eingeschleppten Flussbarsches (Perca fluviatilis) im Grundlsee.]'' Österreichs Fischerei 2006:20–27. ('''''Saiblinglaich-Räuber''''')
| |
| − | | |
| − | Gassner 1999, H. & Wanzenböck, J.: → ''[https://doi.org/10.1016/S0075-9511(99)80051-6 Fischökologische Leitbilder fünf ausgewählter Salzkammergutseen]''. Limnologica 1999, S. 436-448. (Inst. f. Limnologie der Österr. AdW, Mondsee)
| |
| − | | |
| − | Gassner 2000, Hubert; Wanzenböck, Josef; et al.: → ''[https://dafne.at/content/report_release/df970a84-0b18-4857-93e6-71f94156dd8b_0.pdf Fischbestände und die ökologische Funktionsfähigkeit stehender Gewässer.]'' Projektbericht der Österr. AdW. 127 Seiten. (wissenschaftlich; Mondsee, Hallstättersee, Irrsee, Wallersee; Methodik; Fischarten-Gilden; Fischbiomassen/ha (abh. von „P“); viele Daten)
| |
| − | | |
| − | Gassner 2006, H.; Jagsch, A. et al.: → ''[Long-term Changes in Environmental Variables of Traunsee, an Oligotrophic Austrian Lake Impacted by the Salt Industry, and Two Reference Sites Hallstättersee and Attersee.]'' Water, Air, & Soil Pollution: Focus 2002: S. 9-20. ('''''Attersee = ultra-oligotoph''''')
| |
| − | | |
| − | Barbara Ritterbusch Nauwerck (2019): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_72_0152-0158.pdf Die Berufsfischerei am '''Mondsee im 20. Jahrhundert''' – Zeitzeugen berichten.]'' – Österreichs Fischerei 2019:152–158.
| |
| − | | |
| − | Ritterbusch Nauwerck 2019, Barbara: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_72_0190-0198.pdf Die Berufsfischerei am '''Mondsee im 20. Jahrhundert''' – Zeitzeugen berichten.]'' Österreichs Fischerei 2019:190–198.
| |
| − | | |
| − | ====Biologen zum Fischbesatz====
| |
| − | | |
| − | Nauwerck 1989, Arnold: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_42_0276-0285.pdf Veränderungen im '''Fischbestand des Mondsees seit 1955''': Ursachen - Wirkungen – Konsequenzen]'' – Österreichs Fischerei – 42:276–285. (Fänge, Besatz, Nutzen?)
| |
| − | | |
| − | Ritterbusch-Nauwerck 1996, Barbara: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_49_0056-0060.pdf Natürliche Fischpopulationen und Seenbewirtschaftung in Österreich]'' – Österreichs Fischerei – 49: 56 - 60. (Bild, wie sich im Laufe der Zeiten die Ansichten über den Sinn und Nutzen der Seenbewirtschaftung gewandelt haben; 1983: "Am Hallstätter See wird der künstliche Besatz gänzlich eingestellt, weil der Ausfang durch diese Maßnahme nicht gesteigert werden konnte (Statistik
| |
| − | lückenlos seit 1909)".)
| |
| − | | |
| − | Baer 2007, Janet al.: → ''[https://www.researchgate.net/publication/280736798_Gute_fachliche_Praxis_fischereilicher_Besatzmassnahmen/link/55c480df08aeca747d6010c3/download Gute fachliche Praxis fischereilicher Besatzmaßnahmen]''. Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter und Fischereiwissenschaftler Band 14. 158 Seiten. („Fischereilicher Besatz ist das Ausbringen von Fischen mit dem Ziel … habitatbedingte oder durch sonstige Faktoren verursachte Defizite im Bestandaufbau auszugleichen und/oder fischereiliche Erträge auf natürlichem Ertragspotential zu sichern.“)
| |
| − | | |
| − | Imhof 2000, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/MON-V-FISCH_0006_II-XIX.pdf Fischbesatz 2000 - Nachhaltige Hege und Nutzung]''. Monografien Vertebrata Pisces Band 6, '''''Symposion''''' Linz 17.-19. März 2000, 19 Seiten (Positionen vieler Stakeholder)
| |
| − | | |
| − | Jungwirth 2002, Günther (BOKU Wien): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/nat-land_2002_1-2_0014-0026.pdf Österreichs Fischfauna]''. Natur und Land 2002:14–26. (HQ: Besatz; Biologie; Gefährdung; See-Arten)
| |
| − | | |
| − | Hartmann 1990, Jürgen: Fischereiwirtschaft und Fischereibiologie → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_43_0120-0127.pdf Probleme beim Felchenbesatz]''. Österreichs Fischerei 1990: 120–127. (biologisch-ökologische Probleme bei Besatz mit ortsfremden Arten; ''„Besatz kann nie schaden, und je mehr davon, desto sicherer der Erfolg“;'' Fischökologie vs. Gewässerbewirtschaftung, Limnologie vs. Fischereiwissenschaft; usw.)
| |
| − | | |
| − | Hartmann 1990, Jürgen: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_43_0048-0053.pdf Vergrößert der Larvenbesatz den Felchenertrag des Bodensees wesentlich?]'' Österreichs Fischerei 1990:48–53.
| |
| − | | |
| − | Hartmann 1998, Jürgen: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_51_0126-0133.pdf Wachstumsrückgang beim Barsch des Bodensees?]'' Österreichs Fischerei 1998:126–132. (21–23 cm Länge; Jungbarsche bilden für den adulten Barsch und viele andere Arten einen wesentlichen Nahrungsbestandteil; Verbuttung?)
| |
| − | | |
| − | Hartmann 1994, Jürgen: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_47_0046-0050.pdf Hilft der Saiblingsbesatz den Saiblingsarten des Bodensees?]'' Österreichs Fischerei 1994:46–50.
| |
| − | | |
| − | Hartmann 1993, Jürgen et al.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_46_0044-0047.pdf Zunehmende Vermischung der Felchen (Coregonus lavaretus), Gangfisch und Blaufelchen im Bodensee?]'' – Österreichs Fischerei 1993: 44–47.
| |
| − | | |
| − | Meerwald 1982, Fritz: → [https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_35_0002-0004.pdf '''''Ketzerische Gedanken über Fischbesätze'''''] – Österreichs Fischerei – 35:2–4.
| |
| − | | |
| − | ====Weitere Fisch-Biologen und -Bewirtschafter====
| |
| − | | |
| − | Pölzl, E (1926): Der Attersee und seine Bewirtschaftung. Osterr. Fischerei-Ztg. 1926, Nr.11 und 12: S. 85-86; S. 93-94.
| |
| − | | |
| − | Steiner 1979, Volker (Fischbiologe); Gruber, Karl: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/nat-land_1979_5-6_0165-0170.pdf Schutz der Tier- und Pflanzenwelt und natürlicher Lebensräume: Der Seesaibling (Salvelinus alpinus)]''; Natur und Land, 65. Jg., H. 5/6 -1979. 6 Seiten.
| |
| − | | |
| − | Steiner 2000, Volker (Fischbiologe): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/MON-V-FISCH_0006_0097-0099.pdf Besatz gesamtheitlich sehen – Nutzfische und Beifische: Förderung standorttypischer Fischarten]''. Monografien Vertebrata Pisces, 2000.
| |
| − | | |
| − | Ecker 2003, Norbert: → ''[https://docplayer.org/49561246-Die-fischereiliche-bewirtschaftung-des-attersees-am-beispiel-der-reinanke-fischereimeisters.html#download_tab_content Die fischereiliche Bewirtschaftung des Attersees am Beispiel der Reinanke]''. Hausarbeit zur Erlangung des "Fischmeisters"; Seewalchen, März 2003.
| |
| − | | |
| − | Lechner 1999, Barbara: Die Physiogeographie des Attersees. - Diplomarbeit Univ. Innsbruck 1999. 117 Bl. (maschinschr.)
| |
| − | | |
| − | Zach 1980, Otto: → ''[https://www.ooegeschichte.at/media/migrated/bibliografiedb/jbmusver_1980_125_0223-0238.pdf Untersuchungen über das Kleinkrebse- und Rädertierplankton einiger Salzkammergutseen]''. Jahrbuch des OÖMV 1980:223-238.
| |
| − | | |
| − | Plass 2023, Jürgen (Red.): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/BZS_Saeugetiere_OOE_0001-0952.pdf ATLAS der Säugetiere Oberösterreichs]''; Biologiezentrum Linz; Denisia 45 (2023) 952 S.; '''''38 MB'''''.
| |
| − | | |
| − | ===Schonzeiten und Brittelmaße in OÖ und am Attersee===
| |
| − | | |
| − | [[Datei: Schonzeiten und Brittelmaße.png|thumb|490px| Schonzeiten und Brittelmaße in OÖ und Attersee; Quellen: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_7_0076-0077.pdf VO OÖ LReg 1954]''; → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_10_0038.pdf VO OÖ LReg 1957]; → [https://www.lfvooe.at/wp-content/uploads/Schonzeiten-Tabelle-zum-Ausdrucken1.pdf Landes-Fi-Verband OÖ]; → [https://www.sab.at/gewaesser/sab-gewaesser/attersee/attersee-fischereiverordnung.html Attersee Fischerei-VO]'']]
| |
| − | | |
| − | Die sechs Schonzeiten am Attersee stimmen mit jenen des Mondsees ziemlich überein. Bei der Seeforelle sind überregionale (OÖ, Salzburg, Kärnten) Schonzeiten umfassender. Für den Seesaibling hat der Attersee die absolut kürzeste mit weniger als der Hälfte der anderen Schondauern. Der (intensiv besetzte) Hecht wird nur 6 Wochen geschützt, anderswo 4 Monate.
| |
| − | | |
| − | Der Kröpfling sollte schon wegen des qualvollen Fangs ganzjährig geschützt werden. Die angegebene Schonzeit passt mit der Laichzeit lt. Heckel (''"Kröpflinge, laichen im Dezember"'') überein.
| |
| − | | |
| − | Tatsächlich dauert die Laichzeit der Renken am Mondsee (→ ''[https://www.researchgate.net/publication/258396895_Experimental_evaluation_of_the_spawning_periods_of_whitefish_Coregonus_lavaretus_complex_in_Lake_Mondsee_Austria/link/00463528238d06e1e8000000/download Wanzenböck 2012]'') von Mitte Dezember bis Mitte Jänner; jene der (baltischen) Maränen von November bis Anfang Dezember. Am Mondsee sind mit der Schonzeit die beiden Laichzeiträume abgedeckt. Da sich die beiden Laichzeiten aber überlappen ist die Entstehung von Hybriden offensichtlich. Damit entsteht für die Mondsee-Renke aber ein genetisches Problem.
| |
| − | | |
| − | '''''Heckel''''' schreibt aber auch: ''"Rheinankeln laichen [am Attersee] im Februar und März"'', was mit den Schonzeiten des Attersees gar nicht übereinstimmt. '''''Einsele''''' gibt für die Große Schwebrenke als Laichzeit Mitte Jänner bis Mitte März an. Auch diese Laichzeiten passen nicht mit der Schonzeit zusammen.
| |
| − |
| |
| − | An allen Seen (Attersee, Mondsee, Salzburger und Kärntner Seen) werden die Reinanken und die Maränen in einen Topf geworfen, als wenn sie die ''gleichen Laichzeiten hätten'' – vielleicht verlässt man sich gänzlich auf den Besatz, wodurch aber die <u>''bodenständigen, angepassten Species''</u> verloren gehen könnten (vgl. → ''[https://www.researchgate.net/publication/258396895_Experimental_evaluation_of_the_spawning_periods_of_whitefish_Coregonus_lavaretus_complex_in_Lake_Mondsee_Austria/link/00463528238d06e1e8000000/download Wanzenböck 2012]'').
| |
| | | | |
| − | ''„Futterfische“'' für den Hecht sind wenig oder nicht geschützt. Wovon sich die erwünschten '''''kapitalen Hechte''''' ernähren sollen ist ein offenes Geheimnis. In Kärnten sind demgegenüber Seelaube, Elritze und viele Kleinfische ganzjährig geschützt und das Mindestmaß für den Hecht ist höher (v.a. am Ossiachersee: 70 cm), aber auch jenes für Seeforelle und Seesaibling. Die Elritze ist nur am Mondsee ganzjährig geschützt, nicht aber am ''„Elritzensee“'' Attersee.
| + | Nur bei Wasser steigt die Dichte beim Erwärmen von 0°C auf 4°C zunächst etwas an und beginnt erst dann zu sinken. Dieser Umstand ist lebensnotwendig für das Leben in Gewässern, denn das 4°C kalte Wasser sinkt nach unten. Die Gewässer können dadurch im Winter nicht vollständig durchfrieren und die Wassertiere können in der Nähe des Gewässerbodens überleben. |
| | | | |
| − | Wie man der ''„Verbuttung“'' des Barsches (viel zu viele Jungbarsche fressen einander ab dem Spätsommer alle jungen Kleinfische weg) beikommen will, ist offen. ''[Anm.: Große Barsche fressen bevorzugt Jungbarsche ["je größer der Barsch, desto kannibalischer"], sodass den Verbliebenen mehr Futter bleibt und diese wieder große Barsche werden können.]''
| + | Die Dichteänderung von Wasser nimmt mit steigender Temperatur (vgl. die Grafik) rasch zu: Der Unterschied zwischen 24 und 25 °C ist dabei ungefähr 26-mal so groß, wie jener zwischen 4 und 5 °C. Als Faustregel kann gelten, dass Wasser bei 25 °C um rund 0,5 % leichter ist als bei 4 °C. Bei Seen resultiert daraus die große vertikale Schichtungsstabilität im Sommer. |
| | | | |
| − | ===Fisch-Besatz und Besatzstrategie für den Attersee===
| + | Gleichzeitig bedeutet dies, dass nur im Frühjahr und im Spätherbst – wenn das (sauerstoffreiche) Oberflächenwasser und das Tiefenwasser gleiche Temperatur und damit gleiche Dichte haben – es zu einer Umwälzung des gesamten Seewassers kommt; nur dadurch wird ermöglicht, dass auch in großer Wassertiefe genügend Sauerstoff für Lebewesen vorhanden ist. |
| | | | |
| − | [[Datei: Attersee-Besatz.png|thumb|510px| Fischereirevier Attersee: Langfristiger Fisch-Besatz und Besatzstrategie für den Attersee]]
| + | ===Dichte-Anomalie von Eis/Wasser=== |
| − |
| |
| − | "Die Einnahmen aus der Bojenvereinbarung mit der Republik Österreich werden vertraglich gesichert ausschliesslich für den Fischbesatz am Attersee verwendet. Der Sportanglerbund Vöcklabruck unter Obmannschaft Mag. Josef Eckhardt hat diese Vereinbarung im sogenannten '''''Bojenprozess''''' für das Revier Attersee erstritten. Mittlerweile beläuft sich diese Entschädigung auf mehr als € 120.000,- pro Jahr. Diese Entschädigung ist zweckgebunden und wird auf Initiative von Mag. Eckhardt ausschließlich für den Fischbesatz lt. Besatzplan verwendet. Die Ziele des Sportanglerbundes Vöcklabruck liegen in der Erhaltung der '''''natürlichen Fischfauna''''' und dem '''''Schutz unserer Gewässer'''''."
| |
| | | | |
| − | "Der Besatz ist ausgewogen und sowohl auf die Netz- als auch auf die Angelfischerei ausgerichtet. Natürlich liegt der Hauptanteil, passend für den Lebensraum Attersee, bei den Coregonen. Aber auch hier hat die Angelfischerei ihren Anteil, da ja der Hauptanteil bei den, auch für Angler fangbaren, Maränen liegt. Der Rest des Besatzes setzt sich aus Karpfenartigen und Hechten zusammen. Der → ''<u>[https://www.sab.at/gewaesser/sab-gewaesser/attersee/fischbesatz-attersee.html Besatzplan für den Attersee]</u>'' wurde vom '''''Fischereirevier Attersee''''' erstellt und ist auch längerfristig sehr sinnvoll und gut für den Attersee."
| + | Im Allgemeinen hat ein Stoff im festen Zustand eine größere Dichte als im geschmolzenen Zustand: Ein Eisenstück sinkt in einer Eisenschmelze genauso auf den Boden wie eine Kerze in flüssigem Wachs. Eis dagegen schwimmt auf flüssigem Wasser, denn die Dichte von Eis ist mit 0,92 g/cm<sup>3</sup> geringer als die Dichte von flüssigem Wasser (1 g/cm<sup>3</sup>). Eis ist daher bei 0 °C um rund 8,4 % leichter als Wasser. Dies bedingt auch, dass Seen von oben her zufrieren. Diese Anomalie ist darauf zurückzuführen, dass sich beim Gefrieren eine Gitterstruktur mit Hohlräumen bildet. In Form von Eis sind dadurch die Wasser-Teilchen weniger dicht gepackt als im flüssigen Wasser oder, was das gleiche bedeutet, Wasser dehnt sich beim Übergang in Eis um rund ein Elftel aus. Daher auch die Sprengwirkungen von in Rissen und Spalten gefrierendem Wasser. |
| | | | |
| − | ===Der Wildbach "Dexelbach"=== | + | ===Spezifische Wärme, Schmelzwärme und Verdunstungswärme=== |
| | | | |
| − | Moog 1981, Otto; Merwald, I.; Jungwirth, M.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_34_0107-0112.pdf Der Dexelbach - zur Limnologie eines Flyschwildbaches. Teil 1]'' – Österreichs Fischerei 1981:107-112.
| + | Spezifische Warme ist die Energiemenge, um 1 kg eines Stoffes um 1 °C zu erwärmen. Bei Wasser ist das die Definition einer „Kilokalorie“ (1 kcal = 4,1868 kJ) für die Erwärmung von 1 kg Wasser von 14,5 auf 15, 5 °C. Die vergleichsweise hohe spezifische Wärme von Wasser bedeutet, dass hohe Wärmemengen gespeichert werden und damit z.B. große Wasserkörper das Klima stark beeinflussen. Zugleich ergibt sich daraus, dass Wasser ein hohes thermisches Puffervermögen gegenüber tages- und/oder jahreszeitlichen Temperaturschwankungen besitzt. |
| | | | |
| − | Moog 1981, Otto; Merwald, I.; Jungwirth, M.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_34_0169-0181.pdf Der Dexelbach - zur Limnologie eines Flyschwildbaches. Teil 2: Benthosbesiedlung und fischereiliche Verhältnisse]'' – Österreichs Fischerei 1981:169–181.
| + | Gegenüber Wasser hat Eis eine geringere spezifische Wärme von nur 0,49 kcal/kg (= 2,04 kJ/kg) um (kaltes) Eis um 1 °C (z.B. von -8 °C auf -7 °C) zu erwärmen. |
| | | | |
| − | Meerwald 1986, Ingo; → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_39_0293-0305.pdf Wildbäche als Fischgewässer.]'' Österreichs Fischerei 1986:293–305. (Dexelbach)
| + | Demgegenüber beträt die spezifische Schmelzwärme von Eis zu Wasser mit 80 kcal/kg (= 335 kJ/kg) ein Vielfaches. |
| | | | |
| − | Merwald, Ingo, 1984: Untersuchung und Beurteilung von Bauweisen der Wildbachverbauung in ihrer Auswirkung auf die Fischpopulation. Dargestellt am Dexelbach – einem Flyschwildbach. Dissertation, 334 Seiten und Planbeilagen, hektographiert, gebunden.
| + | Da beim Verdunsten die Wasserstoffbrücken überwunden werden müssen, lässt sich Wasser nur mit sehr hohem Energieaufwand verdunsten: um 1 Liter Wasser zu verdunsten sind 539 kcal/kg (= 2.257 kJ/kg) Energie erforderlich. |
| | | | |
| − | ===Geordnete Literatur zur Fischerei am Attersee===
| + | Die spezifischen Wärmen je kg (und °C) von Eis-Erwärmen : Eis-Schmelzen : Wasser-Erwärmen : Wasser-Verdampfen verhalten sich zueinander wie '''0,5 : 80 : 1 : 539'''. |
| | | | |
| − | ====Geschichte der Fischerei==== | + | ==Wassertemperatur und Gewässer== |
| | | | |
| − | Kindler 1951, Franz: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_4_0171-0175.pdf Die Fischereirechte und das Grundbuch]'' – Österreichs Fischerei – 4:171–175.
| + | Butz 1985, Ilse: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_38_0065-0068.pdf Wassertemperatur und Gewässer 1. Teil]'' – Österreichs Fischerei – 38:65-68. → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_38_0144-0148.pdf 2. Teil]'' – Seite:144–148; → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_38_0196-0199.pdf 3. Teil]'' – Seite:196–199; → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_38_0241-0244.pdf 4. Teil]'' – Seite 241–244 |
| − | | |
| − | Brachmann 1951, Gustav: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_4_0074-0077.pdf Geschichte der Fischerei in Österreich (Teil I)]'' – Österreichs Fischerei – 4:74–77. → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_4_0220-0222.pdf (Teil II)]'' Seite 220–422. → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_4_0245-0247.pdf (Teil III)]'' Seite 245-247. → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_5_0112-0114.pdf (Teil IV)]'' Seite 112-114. → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_5_0133-0135.pdf (Teil V)]'' 5eite 133-135.
| |
| | | | |
| − | Brachmann 1953, Gustav: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_6_0159-0161.pdf Die älteste Fischerei-Ordnung von Oberösterreich (Teil 1; Traun)]'' – Österreichs Fischerei – 6: Seite 159-161. → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_6_0170-0173.pdf (Teil 2)]'' Seite 170-173. → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_7_0005-0006.pdf (Teil 3)]'' Seite 5-6. → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_7_0024-0026.pdf (Teil 4)]'' Seite 24-26.
| + | ==Zugefrorener Attersee und Bodensee 1962/63== |
| | | | |
| − | ====Forschungen zu Salzkammergutseen====
| + | Einsele 1963, Wilhelm: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_16_0067.pdf Der Winter 1962/63, die Gewässer und die Fischerei]'' – Österreichs Fischerei – 16: 67. |
| − | | |
| − | ZELLERSEE/IRRSEE: https://issuu.com/frandl/docs/zell_am_moos
| |
| − | | |
| − | Einsele 1959, Wilhelm: → [https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_12_5-6_0007.pdf Vorwort] – Österreichs Fischerei – 12_5-6: 7. | |
| − | | |
| − | Einsele 1959, Wilhelm;, Jens Hemsen: → [https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_12_5-6_0009-0031.pdf Über die Gewässer des Salzkammergutes, insbesondere über einige Seen] – Österreichs Fischerei – 12_5-6:9–31. (alle Seen; Attersee)
| |
| − | | |
| − | Findenegg 1959, Ingo: → [https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_12_5-6_0032-0035.pdf Das pflanzliche Plankton der Salzkammergutseen] – Österreichs Fischerei – 12_5-6:32–35
| |
| − | | |
| − | Schadler 1959, Josef: → [https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_12_5-6_0036-0054.pdf Zur Geologie der Salzkammergutseen] – Österreichs Fischerei – 12_5-6:36–54.
| |
| − | | |
| − | Danecker 1965, Elisabeth: → [https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_18_0034-0046.pdf Die Schnecken und Muscheln unserer Fischwässer] – Österreichs Fischerei – 18:34–46.
| |
| − | | |
| − | Einsele 1959, Wilhelm: → [https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_12_5-6_0055-0087.pdf Das Bundesinstitut für Gewässerforschung und Fischereiwirtschaft in Scharfling am Mondsee - Arbeit und Aufgaben] – Österreichs Fischerei – 12_5-6:55–87. (viel zu den Renken vom Attersee)
| |
| − | | |
| − | ====Artenwechsel====
| |
| − | | |
| − | Schmall 2014, Berhard; Thomas Friedrich (2014): → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_67_0095-0109.pdf Die Störarten der Donau]''''' – Österreichs Fischerei – 67: 95–109. (Teil 1: Hausen, Belugastör (Huso huso) – bis 500 kg; tolle Bilder); → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_67_0129-0143.pdf Teil 2:]''''' Waxdick (Acipenser gueldenstaedtii), Glattdick (Acipenser nudiventris), Sternhausen (Acipenser stellatus) und historische Störnachweise zweifelhafter Identität – Seite 129–143; → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_67_0167-0183.pdf Teil 3:]''''' Sterlet, »Stierl« (Acipenser ruthenus) und aktuelle Schutzprojekte im Donauraum – Seite 167– 183.
| |
| − | | |
| − | Penzes 1972, Bethen: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_25_0069-0073.pdf Wohin verschwinden die Donau-Sterlets?]'' – Österreichs Fischerei – 25:69–73. (s.a. 500-kg-Hausen!)
| |
| − | | |
| − | Nauwerck 1989, Arnold: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_42_0276-0285.pdf '''Veränderungen im Fischbestand des Mondsees seit 1955''': Ursachen - Wirkungen – Konsequenzen]'' – Österreichs Fischerei – 42:276–285.
| |
| − | | |
| − | Tesch 1986, Friedrich: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_39_0005-0020.pdf Der Aal als Konkurrent von anderen Fischarten und von Krebsen]'' – Österreichs Fischerei – 39:5–20.
| |
| − | | |
| − | Zick 2006, Daniela; Gassner, H.; Jagsch, A.; Patzner, R.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_59_0020-0027.pdf Auswirkung und Populationsentwicklung des '''eingeschleppten Flussbarsches''' im Grundlsee (Stmk)]'' – Österreichs Fischerei – 59:20–27.
| |
| − | | |
| − | Hartmann 1992, Jürgen: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_45_0051-0054.pdf Kannibale Bodenseebarsch]'' – Österreichs Fischerei – 45:51–54.
| |
| − | | |
| − | Rule 2005, Chr. et al.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_58_0230-0262.pdf Die Seeforelle im Bodensee und seinen Zuflüssen: Biologie und Management]'' – Österreichs Fischerei – 58:230–262.
| |
| − | | |
| − | Spitzy 1971, Reinhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_24_0021-0029.pdf Resistente, amerikanische Krebse ersetzen die europäischen, der Krebspest erliegenden Astaciden]'' – Österreichs Fischerei – 24:21–29.
| |
| − | | |
| − | Weber 1971, Edmund: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_24_0100-0102.pdf Die Einbürgerung von asiatischen Fischen in Österreich]'' – Österreichs Fischerei – 24:100–102. (AMUR)
| |
| − | | |
| − | Hadl 1978, Gerhard; Otto Moog, Afra Müller-Jantsch, G. Müller: → [https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_31_0163-0165.pdf Zum Auftreten der Wandermuschel Dreissena Polymorpha Pallas im Salzburger und oberösterreichischen Salzkammergut] – Österreichs Fischerei – 31:163–165.
| |
| − | | |
| − | ====Zugefrorener Attersee und Bodensee 1962/63====
| |
| − | | |
| − | Einsele 1963, Wilhelm: → [https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_16_0067.pdf Der Winter 1962/63, die Gewässer und die Fischerei] – Österreichs Fischerei – 16: 67.
| |
| | | | |
| − | Einsele 1963, Wilhelm: → [https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_16_0068-0072.pdf Am 31. März 1963 ging das Eis im Attersee unter!] – Österreichs Fischerei – 16:68–72. (Eisbruch) | + | Einsele 1963, Wilhelm: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_16_0068-0072.pdf Am 31. März 1963 ging das Eis im Attersee unter!]'' – Österreichs Fischerei – 16:68–72. (Eisbruch) |
| | | | |
| − | Wagner 1963, Gustav: → [https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_16_0073-0074.pdf Die totale "Seegfrörne" des Bodensees im Winter 1962/63] – Österreichs Fischerei – 16:73–74. | + | Wagner 1963, Gustav: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_16_0073-0074.pdf Die totale "Seegfrörne" des Bodensees im Winter 1962/63]'' – Österreichs Fischerei – 16:73–74. |
| | | | |
| − | ====Wassertemperatur und Gewässer==== | + | ==Jährlich zweimalige Vollzirkulation des Atterseewassers== |
| | | | |
| − | Butz 1985, Ilse: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_38_0065-0068.pdf Wassertemperatur und Gewässer 1. Teil]'' – Österreichs Fischerei – 38:65-68. → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_38_0144-0148.pdf 2. Teil]'' – Seite:144–148; → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_38_0196-0199.pdf 3. Teil]'' – Seite:196–199; → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_38_0241-0244.pdf 4. Teil]'' – Seite 241–244
| + | Das gesamte Attersee-Wasser durchmischt sich wegen der Tiefe des Attersees zwei Mal pro Jahr (''"Vollzirkuation"''). |
| | | | |
| − | ===Einige Fisch-Portaits (mit tollen Bildern)===
| + | Im Sommer gibt es eine scharfe Trennung des warmen Oberflächenwassers gegenüber dem jahresdurchgängig 4 °C kalten Tiefenwasser. |
| | | | |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_67_0067-0071.pdf Perlfisch, Aitel oder Hasel]''''' <br />
| + | [[Datei: Verdunstung 2.11.23.jpg|thumb|310px| Herbstliche Verdunstung am Attersee am 2.11.2023 bei Wassertemperatur 15 °C und Lufttemperatur 5 ° C]] |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_50_0210.pdf Seelaube, Mairenke, Schiedling]''''' <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_50_0174.pdf Elritze oder Pfrille]''''' <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_58_0169-0173.pdf Hochzeitszug der Nase]''''' <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_50_0246.pdf Koppe, Groppe]''''' <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_58_0209.pdf Die Koppe]''''' <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_50_0106.pdf Der Bitterling]''''' <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_50_0142.pdf Schlammpeitzger]''''' <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_51_0110.pdf Dreistacheliger Stichling]''''' <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_51_0038.pdf Streber (Zingel) ]''''' <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_67_0023-0026.pdf Zander oder Wolgazander]''''' <br />
| |
| | | | |
| − | ===Herkunft und Bedeutung der Namen unserer Fische samt Bild===
| + | Im Herbst gibt der See seine Wärmeenergie vorrangig mittels Verdunstung an die kältere Luft ab. Da die Verdunstungswärme des Wassers sehr hoch ist, kommt diesem Effekt das Hauptgewicht der Wärmeabgabe zu (vgl. die nebenstehende Abbildung). |
| | | | |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_56_0111-0112.pdf 1. Neunaugen]''''' (Augen und Kiementaschen erwecken den Eindruck von "neun" Augen<br />
| + | Im Verlauf des Winters kommt es dann zu einer Angleichung der Temperatur des Oberflächen- und des Tiefenwassers mit ca. 4 °C. Damit wird die '''''<u>erste Zirkulation</u>''''' des Wassers des gesamten Attersees ermöglicht, die durch Wind und Wellen begünstigt wird. |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_56_0149-0150.pdf 2. Nase]''''' (Der Wortstamm »nas-« für Nase (eigentlich Nasenloch, Nüster) ist indogermanischen Ursprungs.) <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_56_0191.pdf 3. Ziege]''''' (Gerader Rücken und gebogener, kielartiger Bauch erinnern an Ziegenkonturen.) <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_56_0230-0231.pdf 4. Hecht]''''' Der Name „Hecht“ gehört zur Verwandtschaft von Haken und ist eng mit der Hechel verwandt, einem Gerät mit scharfen Drahtspitzen zum Durchziehen und Reinigen von Flachs oder Hanf. Gebräuchlicher ist uns aus dieser Wortfamilie ein Haushaltsgerät, die Hachel. Der Hecht heißt also wegen seinem mit spitzen Zähnen bewehrten Raubfischgebiss so.<br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_57_0032.pdf 5. Sterlet]''''' Der Name Sterlet kommt als Lehnwort vom russischen Namen dieses Fisches, "Sterlyad." <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_57_0097-0098.pdf 6. Nerfling]''''' (Name (früher „Örfling“) vom griech.-latein. „Orphus“, einem »rötlichen Meerfisch«.) <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_57_0133-0134.pdf 7. Äsche]''''' (Fisch nach seiner aschgrauen Farbe benannt. Alte Bezeichnung ist Asch (ahd asco; mhd asche).)<br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_57_0170-0172.pdf 8. Forellen]''''' (Der Name entwickelte sich aus mhd. forhele, ahd. for(a)hana. Die westgermanische Bezeichnung ist auf eine indogermanische Wurzel ''"perk"'' – »gesprenkelt, bunt« zurückzuführen, von der auch das Wort ''Farbe'' abgeleitet werden kann.) <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_58_0027-0028.pdf 9. Karpfen]''''' (Mit der neuen Art wurde auch ihr slawischer Name übernommen ohne lokale Bezeichnungen.) <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_58_0068-0069.pdf 10. Saibling]''''' (Zu dem aus dem Lateinischen entlehnten Wort „Salm“ für den Lachs wurde die im süddeutschen Raum beliebte Endung »-ling« (vgl. Äschling für Äsche, Näsling für Nase, Sichling für Ziege, Nerfling, Gründling, Bitterling u.v.m) angefügt. So wurde aus dem Salm im Bairischen der Salmling, Sälmling, Salbling oder Sälbling und letztlich der Saibling.) <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_58_0099.pdf 11. Barbe]''''' (Der Name leitet sich aus dem Lateinischen ''barba'' (= Bart) ab.) <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_58_0137-0139.pdf 12. Koppe]''''' (Name ist frühes Lehnwort aus Latein und stammt von cupa, cuppa (= Becher, kugeliges Trinkgefäß).) <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_58_0206-0208.pdf 13. Rotauge und Rotfeder]''''' (Name von roter Farbe, lateinisch rutilus bedeutet »rötlich schimmernd, rötlichgelb«.) <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_59_0033-0034.pdf 14. Perlfisch und Frauennerfling]''''' (Er verdankt seinen Namen dem überaus stark ausgebildeten »perlenartigen«
| |
| − | Laichausschlag.) <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_59_0066-0068.pdf 15. Gründling, Steingressling, Weißflossengründling und Kessler-Gründling]''''' (Namen deuten auf die Lebensweise der Fische (am Grund lebend) hin.) <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_59_0100-0101.pdf 16. Schmerle]''''' (Der seit dem Frühneuhochdeutschen als smerle und smirlinc auftretende Name Schmerle hat ungewisse Wurzeln.) <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_59_0134-0135.pdf 17. Schlammpeitzger]''''' (hat Vorliebe für schlammige Substrate) <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_59_0238-0239.pdf 18.Welse]''''' (Die Worte Wels und auch Waller (Waler, Weller) stammen aus derselben sprachlichen Wurzel wie Wal (Walfisch), welches aus dem germanischen hwalis entstanden ist.) <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_59_0208.pdf 19. Steinbeißer]''''' (Seinen Namen verdankt der Steinbeißer der charakteristischen Nahrungsaufnahme: Er saugt Sand und Schwebstoffe ins Maul und stößt die unverwertbaren Teile durch die Kiemenöffnungen wieder aus.) <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_60_0030-0031.pdf 20. Schleie]''''' (Alles an der Schleie (Tinca tinca) macht einen glatten und glitschigen Eindruck, selbst die Flossenränder sind rund und sanft geformt. Der Name Schleie kann auf eine alte indogermanische Wurzel zurückgeführt werden: dieses [s]lei bedeutet »feucht, schleimig, klebrig sein«.) <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_60_0094-0096.pdf 21. Aalrutte]''''' (Die Aalrutte oder einfach Rutte kam vermutlich zu ihrem Namen, weil sie die Menschen nicht nur an einen Aal, sondern auch an eine Kröte oder einen Frosch erinnerte) <br />
| |
| − | → '''''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_60_0142-0144.pdf 22. Brachse]''''' (Der Name Brachse entwickelte sich aus mhd. brahsem, ahd. brahsema, brahsa, brachsma. Er gehört zur Wortgruppe um mhd. brehen, was »plötzlich aufleuchten« bedeutet. Das glänzende Schuppenkleid hat also der Brachse zu ihrem Namen verholfen.) <br />
| |
| − | '''''R(h)einanke:''''' In Vorarlberg werden die Seeforellen von Ill und Rhein als Illanken und Rheinlanken bezeichnet. Es handelt sich um die Seeforellen, die vom Bodensee in Ill und Rhein zum Laichen aufsteigen. Der ursprüngliche Name ist Rheinanke. Die Herkunft des Grundwortes ''Anke'' ist unklar. Vermutlich wird auf den Fettgehalt der Fische angespielt, denn mhd. anke, ahd. ancho ist das alte Wort für Butter und Schmalz.
| |
| | | | |
| − | ==Eutrophie – Oligotrophie – Fischertrag==
| + | Im Verlauf des Winters kühlt das Oberflächenwasser weiter ab (von 4 °C auf bis zu 0 °C), sodass es wiederum zu einer Trennung von Oberflächen- und Tiefenwasser kommt. |
| | | | |
| − | [[Datei: Phosphor-Biomasse.png|thumb|320px| Phosphorgehalt in mg/m<sup>3</sup> und Fischbiomasse in kg/ha]]
| + | Im Frühjahr kommt es mit der Erwärmung des Oberflächenwassers auf wiederum 4 °C zur gleichen Situation wie im Winter mit gleicher Temperatur von Oberflächen- und Tiefenwasser, sodass es zu einer '''''<u>zweiten Zirkulation</u>''''' des gesamten Atterseewassers kommt. |
| | | | |
| − | Dokulil 2017, Martin: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/VZBG_154_0001-0053.pdf Alpenrandseen im Anthropocän: Verschlechterung und Sanierung – eine österreichische Erfolgsgeschichte]''. Acta ZooBot Austria 154, 2017, 1–53. [Behandlung des Attersees auf S. 23–26]
| + | Diese zweifache Zirkulation des Seewassers bewirkt, dass auch in den kalten Tiefen des Attersees ganzjährig Wasser mit hohem Sauerstoffgehalt vorhanden ist. |
| − | | |
| − | Laut Dokulil gibt es eine "Abhängigkeit der Zooplankton-Biomasse von der Menge an vorhandenem Phytoplankton. Bezogen auf die Biomasse unter einem Quadratmeter Seeefläche erklärt das Phytoplankton sogar 90 % der Varianz des Zooplanktons. Dieser Zusammenhang unterstreicht die Bedeutung des Phytoplanktons als Nahrungsgrundlage für das Zooplankton. Eine Kombination der Relationen ermöglicht theoretisch auch eine Ableitung der möglichen Biomasse des Zooplanktons aus dem Gesamtphosphor, welcher auch als Basis für die Abschätzung der Fischbiomasse herangezogen werden kann (p. 639; nach Gassner et al. 2003; vgl. die nebenstehende Grafik)".
| |
| − | | |
| − | Dass dem nicht so ist, zeigt eine Nachrechnung der Korrelation dieser zitierten und angeführten Grafik, wie anhand der vier nachstehenden selbst erstellten Grafiken nachvollzogen wird. Die erste Grafik wird anhand der Original-Daten erstellt. Lässt man nur den – wegen des doppelten Ertrags – unglaubwürdigen Maximalwert weg, sinkt die Regression deutlich, wie der zweiten Grafik zu entnehmen ist. Lässt man auch die 12-mg-Phosphorwerte weg, wird die Regressionsgerade wiederum flacher. Falls man auch die 10-mg-Phosphorwerte streicht, wird sie wirklich flach. Durch eine Erhöhung des Phosphor-Gehalts auch auf das 2,5-fache erhöht sich die Fischbiomasse nur mehr auf das 1,4-fache. Daraus erkennt man, dass z.B. für den Attersee, der weit unter diesen Phosphor-Werten liegt, das Fischgewicht je ha nicht von der Oligotrophie abhängt. Es ist eher davon auszugehen, dass andere Faktoren (z.B. verfügbares Zooplankton, Verfügbarkeit von jungen Besatzfischen ''(?)'' oder heimischen Kleinfischen wie Elritzen als Futterfische usw.) wesentlicher sind.
| |
| − | | |
| − | <gallery>
| |
| − | Phosphor-Biomasse 4 – 3.png| 4xPhosphor - 3xGewicht <br /> Originaldaten-Rechnung|alt=alt language
| |
| − | Phosphor-Biomasse 4 – 2,5.png|4xPhosphor - 2,5xGew. <br /> Re. ohne Maximalwert|alt=alt language
| |
| − | Phosphor-Biomasse 3 – 1,7.png|3xPhosphor - 1,7xGew. <br /> ohne 12mg-Phosph-Wert|alt=alt language
| |
| − | Phosphor-Biomasse 2,5 – 1,4.png|2,5xPhosphor - 1,4xGew<br /> ohne 10mg-Phosph-Wert|alt=alt language
| |
| − | </gallery>
| |
| − | | |
| − | ÖWWV-Mitteilungen, OÖ-LK (1984): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_37_0008-0009.pdf Seen-Sanierungsprogramm in Oberösterreich in der Endphase]'' – Österreichs Fischerei – 37:8–9. (Bilder von der Produktion der Rohre und deren Verlegung)
| |
| − | | |
| − | Dokulil 1983, Martin; Pischinger, K.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_36_0241-0244.pdf Die hygienisch-bakteriologische Situation der '''Badebereiche am Mondsee''' im Sommer 1983]'' – Österreichs Fischerei – 36:241–244.
| |
| − | | |
| − | Moog Otto: → ''[https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7054 '''Österreichisches Eutrophieprogramm - Projekt Salzkammergutseen''''']: Arbeiten aus dem Labor Weyregg. '''<u>6 Bände</u>'''
| |
| − | | |
| − | Moog 1989, Otto: → [https://www.researchgate.net/publication/270127390_The_effect_of_reduced_sewage_input_on_the_development_of_an_oligotrophic_lake_Attersee_Austria?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoicHJvZmlsZSJ9fQ Die Effekte eines verringerten Abwassereintrags auf die Entwicklung eines oligotrophen Sees (Attersee)], 1989. ''[Seit 1986 ist Attersee '''''„ultra-oligotroph“'''''.]''
| |
| − | | |
| − | Moog 1988, Otto: → ''[https://www.researchgate.net/profile/Otto-Moog/publication/273453202_Attersee/links/5502b17f0cf231de076f49e1/Attersee.pdf "ATTERSEE"-Nachlese]''. In Buch: Seenreinhaltung in Österreich. II. Teil (S. 164–172)
| |
| − | | |
| − | Moog 1983, Otto: → ''[https://www.academia.edu/30213718/_Selbstreinigende_Und_Phosphorr%C3%BCckhaltevorg%C3%A4nge_in_Der_Seenkette_Fuschlsee_Mondsee_Attersee „Selbstreinigende und Phosphorrückhaltevorgänge in Der Seenkette Fuschlsee - Mondsee - Attersee”. '''Ergebnisse des österreichischen Eutrophieprogrammes 1978–1982''''']. Wien 1983. 107 Seiten.
| |
| − | | |
| − | Schindlbauer (1982, Gottfried: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_6_1982_0017-0056.pdf Das hydrographische Einzugsgebiet des Attersees – geographische Untersuchungen als Grundlage für eine Nährstoffbilanzierung]''. – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 6_1982:17-56. 41 Seiten. (Die Bodenverhältnisse um den Attersee usw.)
| |
| − | | |
| − | [[Datei: Phosphorbilanz 1970er.png|thumb|290px| Enorme 1970er-Phosphorbilanz in Seenkette]]
| |
| − | | |
| − | [[Datei: Ringkanalisation.png|thumb|290px| Ringkanalisation – Pumpwerke und Kläranlagen]]
| |
| − | | |
| − | Müller 1979, Günter: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_3_1979_0018-0036.pdf Phosphorbilanz der Seenkette Fuschlsee – Mondsee – Attersee]''. Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 3; 1979: 18–36.
| |
| − | | |
| − | Rep. Österreich (1983): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/MON-ALLGEMEIN_0144_0001-0106.pdf Ergebnisse des österreichischen Eutrophieprogrammes 1978-1982 – Monografien Allgemein]'' – 0144: 1-106.
| |
| − | | |
| − | Otto Moog (1982): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_6_1982_0134-0141.pdf Jahresgang von Phythoplankton und Chlorophyl a im Attersee 1981]''. Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 6_1982: 134 - 141.
| |
| − | | |
| − | Otto Moog (1982): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_6_1982_0003-0016.pdf Nährstoffbilanz 1981 und trophische Charakterisierung von Fuschlsee, Irrsee, Mondsee und Attersee]''. Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 6_1982: 3 - 16.
| |
| − | | |
| − | Otto Moog (1981): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_5_1981_0001-0042.pdf Die Auswirkungen der Nährstoff-Fracht auf die Gewässergüte der Seen im Ager-Einzugsgebiet von Fuschlsee, Mondsee, und Attersee]''– Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 5_1981:1–42.
| |
| − | | |
| − | Otto Moog (1981): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_5_1981_0043-0050.pdf Wasserbilanzierung des Ager-Seenketten-Systems 1989]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 5_1981: 43 - 50.
| |
| − | | |
| − | Otto Moog (1980): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_4_1980_0173-0184.pdf Die Phytoplanktonentwicklung im Attersee 1979 und die Diatomeen-Kieselsäurebeziehung im Attersee]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 4_1980: 173 - 184.
| |
| | | | |
| − | Otto Moog (1980): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_4_1980_0185-0193.pdf Die Silzium - Kieselalgen Beziehung im Attersee]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 4_1980: 185 - 193.
| + | Nur in diesem seit der Eiszeit '''''ganzjährig kalten und sauerstoffreichen Tiefenwasser unseres Attersees''''' konnten unsere eiszeitlichen Fischarten '''''<u>Reinanke und Kröpfling</u>''''' und '''''<u>Seesaibling</u>''''' bis heute überleben: diese beiden Fischarten sind seit rd. 12.000 Jahren die einzigen direkten Nachkommen der Fische der Eiszeit in unserem damals erst entstandenen Attersee. |
| − | | |
| − | Otto Moog (1980): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_4_1980_0006-0030.pdf Die Phosphorbilanz der Ager-Seenkette für die Jahe 1978 und 1979]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 4_1980: 6 - 30.
| |
| − | | |
| − | Otto Moog (1979): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_3_1979_0178-0187.pdf Das Crustaceenplankton des Attersees – Bemerkungen zur Populationsökologie und Stellung in der limnischen Nahrungskette]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 3_1979: 178 - 187.
| |
| − | | |
| − | Otto Moog (1978): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_2_1978_0090-0098.pdf Jahreszyklus, Vertikalverteilung, Biomasse, Populationsdynamik und Produktionsbiologie des Crustaceenplanktons im Attersee]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 2_1978: 90 – 98
| |
| − | | |
| − | Gerhard Hadl, Otto Moog, Afra Müller-Jantsch, G. Müller (1978): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_31_0163-0165.pdf Zum Auftreten der Wandermuschel Dreissena Polymorpha Pallas im Salzburger und oberösterreichischen Salzkammergut]'' – Österreichs Fischerei – 31: 163 - 165.
| |
| − | | |
| − | Hartmann 1980, Jürgen: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_33_0182-0185.pdf Verschiedene Ursachen von Eutrophierungserscheinungen in Gewässern]'' – Österreichs Fischerei – 33:182–185.
| |
| − | | |
| − | Schultz 1971, Günther: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_24_0149-0158.pdf Erste Ergebnisse von 3 Jahren Seenuntersuchungen (1968, 1969, 1970) an einigen Salzkammergutseen und Seen des Salzburger Flachgaues]'' – Österreichs Fischerei – 24: 149 - 158. (Attersee Trinkwasserqualität, Mondsee und Wolfgangsee bereits sehr bedenklich)
| |
| − | | |
| − | Danecker 1969, Elisabeth: → [https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_22_0025-0031.pdf Bedenklicher Zustand des Mondsees Herbst 1968] – Österreichs Fischerei – 22:25-31.
| |
| − | * Eutrophierung, Wasserschichtung, Algenblüte – Blaualge Anabaena flos aquae, welche ihre Fäden zu winzigen lockeren Bällchen zusammenknäult, so daß man sie schon mit freiem Auge als punktförmige Gebilde erkennen kann. Weitere Elemente der Algenblüte waren Ceratium hirundinella, eine gepanzerte Geißelalge, und die Blaualge Oscillatoria rubescens ('''''Burgunderblutalge''''')
| |
| − | | |
| − | ==Die häufigen Wasservögel am Attersee==
| |
| − | | |
| − | Aubrecht 2003, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0124-0125.pdf Höckerschwan]'' – Denisia – 0007:124-125.
| |
| − | | |
| − | Aubrecht 2003, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0218-0219.pdf Lachmöve]'' Denisia – 0007:218-219.
| |
| − | | |
| − | Aubrecht 2003, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0110-0111.pdf Haubentaucher]'' – Denisia – 0007:110-111.
| |
| − | | |
| − | * Hemsen 1957, Jens: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Oesterreichs-Fischerei_10_0139-0141.pdf Ist der Haubentaucher ein Fischereischädling?]'' – Österreichs Fischerei – 10:139–141. (sie fressen zu 2/3 größere Weißfische, zu 1/3 kleine Barsche; ein Tier frisst pro Jahr rd. 40 kg)
| |
| − | | |
| − | Schuster 2003, Alexander: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0202-0203.pdf Blässhuhn]'' – Denisia 0007:202–203.
| |
| − | | |
| − | Müller 1979, Günther, Otto Moog (1979): → ''[https://www.zobodat.at/pdf/EGRETTA_22_1_0001-0003.pdf Nahrung und Verteilung des Bläßhuhns am Mondsee.]'' – Egretta 1979:1-3.
| |
| − | | |
| − | Aubrecht 2003, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0144-0145.pdf Stockente]'', Denisia 0007:144–145.
| |
| − | | |
| − | Aubrecht 2003, Gerhard: → [https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0152-0153.pdf Tafelente] Denisia – 0007:152-153.
| |
| − | | |
| − | Aubrecht 2003, Gerhard: → [https://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0007_0154-0155.pdf Reiherente] Denisia – 0007:154-155.
| |
| | | | |
| | ---- | | ---- |
| | | | |
| − | Aubrecht 1978, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_2_1978_0128-0136.pdf Ergebnisse von drei Wasservogelzählungen am Attersee im Winter 1977]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 2_1978:128-136.
| + | In Seen mit geringer Wassertiefe kommt es zu '''''keiner scharfen Trennung von Oberflächen- und Tiefenwasser''''', wenn das warme Oberflächenwasser bis zum Grund des Sees reicht. Damit wird dieser Wasserkörper laufend bis zum Grund durchmischt und hat in seiner gesamten Tiefe ähnliche Temperatur. Die Nachkommen mancher eiszeitlicher Salmoniden in diesen Seen haben sich offenbar an solche Verhältnisse angepasst. |
| − | | |
| − | Aubrecht 1979, Gerhard; Gert Michael Steiner: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_3_1979_0253-0261.pdf Wasservögel und Makrophyten am Attersee]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 3_1979:253-261.
| |
| − | | |
| − | Winkler 1984, Hans; Gerhard Aubrecht: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/EGRETTA_27_1_0023-0030.pdf Zusammenhänge zwischen überwinternden Wasservögeln und die Beschaffenheit der Uferzone des Attersees]''. – Egretta – 27_1:23-30.
| |
| − | | |
| − | Aubrecht 1979, Gerhard: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/JOM_124a_0193-0238.pdf Die Wasservögel des Attersees 1977 und 1978 - Diskussion der Ursachen für die zeitliche und räumliche Verteilung]''. – Jahrbuch OÖMV – 124a:193-238.
| |
| − | | |
| − | Aubrecht 1981, Gerhard; Otto Moog: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_5_1981_0166-0174.pdf Die Entwicklung des Wasservogelbestandes im Attersee von Winter 78/79 bis Winter 80/81.]'' – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 5_1981: 166 - 174.
| |
| − | | |
| − | Aubrecht 1982, Gerhard; Otto Moog: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/Arb-Labor-Weyregg_6_1982_0179-0182.pdf Der Wasservogelbestand des Winterhalbjahres 1981/1982 am Attersee]''. – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 6_1982: 179 - 182.
| |
| − | | |
| − | ==Die Wasserpflanzen des Attersees==
| |
| − | | |
| − | [[Datei: Attersee Unter Wasser.jpg|thumb|180px|]]
| |
| − | | |
| − | OÖ Landesregierung: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/GWS-Ber_79_0001-0192.pdf '''<u>Phytoplankton</u>''' im Attersee 2013]''. Attersee S. 10–39.
| |
| − | | |
| − | Pall 2010, Karin et al.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/GUTNAT_0685_0001-0038.pdf '''<u>Makrophyten</u>'''kartierung Attersee – Bewertung nach WRRL]''. OÖ Landesregierung 2010, 38 Seiten.
| |
| − | | |
| − | * '''''Makrophyten''''' sind Gewächse, die mit bloßem Auge sichtbar sind. Diese umfassen die höheren Wasserpflanzen und die Armleuchteralgen. Zu den Wasserpflanzen werden nur die aquatischen Makrophyten, also die untergetaucht lebenden gezählt.
| |
| | | | |
| − | * Pall 2010, Karin et al.: → ''[https://www.zobodat.at/pdf/GUTNAT_0683_0001-0123.pdf Makrophytenkartierung Attersee.]'' OÖ Landesregierung 2010, 124 Seiten. (Die Wasserpflanzen des Attersees; alle Orte)
| + | Da biologische Prozesse bei höheren Temperaturen rascher ablaufen – entsprechend einer Verdopplung je 10 ° Temperaturerhöhung – haben diese ''„<u>Warmwasser-Salmoniden</u>“'' einen höheren Stoffumsatz und wachsen schneller als die ''„<u>Kaltwasser-Salmoniden</u>“'' des Attersees. |
| | | | |
| − | Jersabek 2021, Christian: → ''[https://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Dokumente%20UWD%20Abt_WW/Phytoplankton-Bericht%20O%C3%96%20GZ%C3%9CV%202020.pdf Ökologischer Zustand der Seen im Land OÖ]''; 198 Seiten. (Attersee-Phytoplankton; vorkommende Arten; Anzahl; OFFEN: Bilder)
| + | ''[Anm. laut → '''[https://fischereirevier-attersee.at/renkenfischen/ Fischereirevier Attersee:]''' "Die Fangtiefe für Attersee-Maränen liegt zw. 10 und 20 m. Tiefeneinstellung im Frühjahr 10–14 m; im Herbst 16–20 m. Im Frühjahr lohnt sich aber auch Flachwasser mit 5 m Wassertiefe."]'' |
| | | | |
| − | ==Link → [[Literatur zum Attersee]]== | + | ==Link Weitere → [[Literatur zum Attersee]]== |
Informationen zu Wasser- und Lufttemperatur
Besonderheiten unseres Attersees
Die türkise Farbe des Attersees

Die milchig-türkise Färbung des Attersees ist eine Folge der biogenen Entkalkung.

Löslichkeit von Calcit in Wasser abh. von CO
2-Partialdruck und Temperatur

-.-.- Chlorophyll in mg/m³; -x-x- Bomasse in g/m³ unten: im Attersee gedeihende Algenfamilien in %
Kalziumkarbonat (mit der chemischen Formel CaCO3) – früher als „kohlensaurer Kalk“ bezeichnet – ist das Calcium-Salz der Kohlensäure (H₂CO₃ aus H2O + CO2) und besteht im festen Zustand aus einem Ionengitter mit Ca2+-Ionen und CO32--Ionen im Verhältnis 1:1.
Das Kalziumkarbonat im Wasser des Attersees stammt vom Kalk des Höllengebirges und löst sich im Wasser in seine beiden Bestandteile auf - wobei die Löslichkeit von den jeweiligen Umgebungszuständen abhängt.
Die Calcit-Löslichkeit in Wasser (vgl. die nebenstehende Abbildung) sinkt mit steigender Temperatur und – vor allem – sinkendem Kohlendioxid-Partialdruck. In der Grafik zeigt die obere Kurve die Ca2+-Konzentration der gesättigten Lösung (in mg/Liter Wasser) im Gleichgewicht mit nicht gelösten Calcitkristallen im Wasser bei einem CO2-Partialdruck von 300 Pa; die untere Kurve das Gleichgewicht bei einem CO2-Partialdruck von 30 Pa.
Der chemische Prozess lautet:
- CaCO3 + H2CO3- → Ca2+ + 2HCO3- (Lösung des Calcits)
- CaCO3 + H2O → Ca2+ + HCO3- + OH- (Hydrolyse von Calcit)
Das Phytoplankton (= Algen) aber auch die Wasserpflanzen brauchen zur Photosynthese neben Lichtenergie vor allem Kohlendioxid. Die Pflanzen und das Plankton entziehen dazu dem Wasser gelöstes Kohlendioxid. Damit entziehen sie dem Wasser Kohlensäure, die aus Calciumhydrogencarbonat nachgeliefert wird. Dadurch steigt auch der pH-Wert und das Wasser wird alkalischer. Das Calciumhydrogencarbonat zerfällt in Wasser und wasserunlösliches Calciumcarbonat, also Kalk, der in Form winziger - weißer - Kalkkristalle ausfällt.
Diese Kalkkristalle geben dem Atterseewasser den milchigen Farbton. Das Grün des Chlorophylls des Phytoplanktons ergibt in Verbindung mit dem Blau des Himmels die türkise Grundfarbe.
Bei Wasserpflanzen (siehe z.B. in den Aufhamer Buchten) lagert sich das Calciumcarbonat als weißliche Kruste auf den Blättern und Stängeln ab. Durch die Tätigkeit des Phytoplanktons bilden sich im Wasser schwebende feine Kalkkristalle. Diese Kalkkristalle sinken ab und werden als Seekreide abgelagert.
Die Zunahme der Calcitlöslichkeit im Wasser mit steigendem Druck und sinkender Temperatur bedingt aber, dass unterhalb einer kritischen Wassertiefe (ca. 30 m) die Kalkkristalle aber wieder vollständig aufgelöst werden.
Literatur:
- Findenegg 1959, Ingo: → Das pflanzliche Plankton der Salzkammergutseen. Österreichs Fischerei 1959, S. 32-35
- Moog 1982, Otto: → Jahresgang von Phytoplankton und Chlorophyll a im Attersee 1981 – Arbeiten Labor Weyregg – 6_1982: 134–141 (Abb. S. 140)
- Butz 1996, Ilse, Schmid Anna-Maria: → Aqua-Schnee im Attersee?. Österreichs Fischerei 1996, S. 85–91. (Wasserchemie, Planktonarten, biologische Kalkausfällung)
- Schröder 1982, H.: → [ https://www.buchfreund.de/de/d/p/97403843/biogene-benthische-entkalkung-als-beitrag-zur Biogene benthische Entkalkung als Beitrag zur Genese limnischer Sedimente. Beisp.: Attersee (Salzkammergut, OÖ)] (Preis 16 €)
Stehende Wellen am Attersee (und Traunsee)

Stehende Wellen am Attersee und Traunsee Attersee zeigt hier 3 Schwingungen pro Stunde
Stehende Wellen werden durch Luftdruckschwankungen ausgelöst, die eine Gleichgewichtsstörung der Wassermasse zur Folge haben; letztere ist bestrebt, den Gleichgewichtszustand wieder zu erreichen und pendelt nun um diesen mit einer ganz bestimmten Schwingungsdauer, die von der Form des Seebeckens abhängt, solange, bis wieder Ruhe eintritt, was oft erst nach Tagen der Fall ist. Vollständige Ruhe herrscht eigentlich kaum einmal, doch sind für gewöhnlich die Schwankungen so klein, daß sie nicht beachtet werden. Es werden auch Schwingungsknoten, sowie Längs- und Querschwingungen beobachtet. Die Schreibpegelanlagen des hydrographischen Dienstes haben lange Reihen solcher Schwingungen aufgezeichnet, von denen hier ein paar besonders schöne Beispiele wiedergegeben werden (s. Abb.).
Lit.: Rosenauer 1932, Franz: → Über das Wasser in Oberösterreich. JBOÖMV Abb. 8.
„Blasenwerfen“ eines Sees und Schlechtwettereinbruch?
Findenegg schreibt: "Bei uns in Kärnten gilt es als ein Vorzeichen kommenden Schlechtwetters, wenn der Seespiegel beim Rudern „Blasen wirft“ Es handelt sich bei dieser Erscheinung um Schaumblasen, die im Kielwasser des Bootes zurückbleiben und erst nach einigen Minuten bis zu einer halben Stunde wieder verschwinden. Die Erscheinung wird so gedeutet, daß die im Seewasser zu Millionen lebenden mikroskopisch kleinen Algen, das Phytoplankton, schleimartige Stoffe absondert, die sich unter gewissen Umständen, vor allem bei ruhigem Wasserspiegel, im Oberflächenhäutchen des Sees so stark anreichern, daß dieses die Eigenschaften etwa einer Seifenlösung erhält. Wird beim Rudern oder durch die Bugwellen des Bootes Luft ins Wasser gebracht, so kann diese nicht ohne weiteres wieder aus dem Wasser entweichen, sondern sammelt sich als Blase unter dem zähen Oberflächenhäutchen an, bis dieses wie eine Seifenblase „platzt“.
Ich habe einige Jahre hindurch gelegentlich nach Tagen besonders deutlichen Blasenwerfens auf den weiteren Wetterverlauf geachtet und diesen notiert. Es sind im ganzen 21 Fälle. Nur in 4 Fällen folgte in den nächsten 48 Stunden Eintrübung oder Regenwetter. In 5 Fällen folgten noch am selben Tage oder doch innerhalb von 48 Stunden kurze Gewitter, in den übrigen 12 Fällen blieb das Wetter schön, meist sogar viele Tage lang. Daraus kann man wohl den Schluß ziehen, daß das Blasenwerfen mit dem Eintritt schlechter Witterung nichts zu tun hat. Es tritt vielmehr dann auf, wenn sich in der obersten Wasserschichte große Mengen von Planktonalgen ansammeln, was bei Windstille zeitweise der Fall ist. Daß das Blasenwerfen nicht immer, sondern nur periodenweise auftritt, hängt offenbar mit der Menge und Art der jeweils im See vorhandenen Algen zusammen, die im Laufe des Jahres stark wechseln. Daß es sich um keine Reaktion dieser Algen auf eine bestimmte Wetterlage handelt, dürfte aus den mitgeteilten Zahlen hervorgehen."
Lit.: Findenegg 1954, Ingo: → Blasenwerfen und Schlechtwetter? – Österr. Fischerei – 7:36.
[Anm.: Das „Blasenwerfen“ der Seen vor Wetterverschlechterung hängt auch damit zusammen, dass bei sinkendem Luftdruck die im Wasser gelösten Gase ein neues Partialdruck-Gleichgewicht mit den Gasen der Luft anstreben, wodurch das „Ausgasen“ aus dem Seewasser begünstigt wird. Somit hat das „Blasenwerfen“ der Seen doch etwas mit kommendem Schlechtwetter zu tun – vor allem, wenn der Luftdruck sehr rasch sinkt.]
Die Entstehung und Abfolge der vier Atterseen
Die vier Eiszeiten formen unsere Seenlandschaften

Gliederung der Eiszeiten: Zeiten, Temperaturen, Umfang; unser warmes Holozän beginnt plötzlich vor 11.700 Jahren
Die Bildung und Abfolge unserer Seen richtete sich jeweils nach den aufgetürmten Endmoränenwällen nach den vier Eiszeiten Günz, Mindel, Riß und Würm (vgl. die nebenstehende Abbildung):
Nach der Günz-Eiszeit bildeten sich vor etwa 600.000 Jahren die ersten Seen; nach der Mindel-Eiszeit folgten vor 430.000 Jahren die zweiten Seen.
Kohl 2001, Hermann: → Das Eiszeitalter in Oberösterreich – Teil 1. ÖKO.L Zs. für Ökologie, Natur- und Umweltschutz. 2001:18-28. (FARBBILD um den ATTERSEE !!!)
Kohl 2001. Hermann: → Das Eiszeitalter in Oberösterreich – Teil 2. ÖKO.L Zs. für Ökologie, Natur- und Umweltschutz. 2001:26-35. (BILD Abb. 2: Eisüberformtes Becken des Attersees. Die konkave Umformung der Hänge ist gut auf der rechten Bildseite (Umgebung NUSZDORF) zu erkennen.) (Korrekturen bei den Abb. von TEIL 1)
Ibetsberger 2010, H.; Jäger, P.; Häupl. M.: → Der Zerfall des Salzachgletschers und die nacheiszeitliche Entwicklung des Salzburger Gewässernetzes aus der Sicht der Wiederbesiedelung der Salzburger Gewässer mit Fischen. S. 7–54. Salzburger Landesregierung, Reihe Gewässerschutz Nr. 14. (auch ATTERSEE usw.)
Schadler 1959, Josef (Geologe): → Zur Geologie der Salzkammergutseen – Österreichs Fischerei – 12:36–54. [auch zu Eiszeiten und Seenbildung]
Der vor ~80.000 Jahren riesige Mondsee und der dritte Attersee
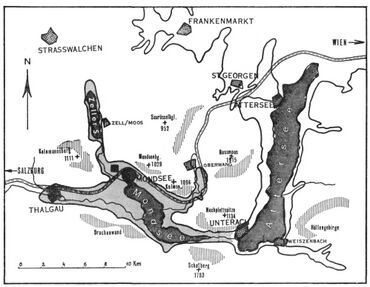
Ausdehnung des interglazialen
Mondsees vor > 80.000 Jahren
Klaus 1975, Wilhelm: → Das Mondsee-Interglazial, ein neuer Florenfundpunkt der Ostalpen. JBOÖMV 120a; 1975:315–344.
Klaus und andere Geologen und Biologen haben anlässlich des Baus der Autobahn um den Mondsee in deren Höhe (rd. 560 m über NN) eindeutige Nachweise eines Sees (Seetone, die von Sanden und Moränengeschieben überlagert waren) vor rd. 80.000 Jahren gefunden.
Im Riß-Spätglazial gibt es zu Beginn vor allem Steppen-Vegetation und Nicht-Baum-Pollen. Das Riß/Würm-Interglazial selbst ist zu Beginn durch Kiefern/Birken, dann mit Kiefer/Birke/Ulme, dann Kiefer/Ulme/Esche und in der Folge von Wälder mit überwiegend Fichte, Ulmen, Erlen, Eschen und Eichen geprägt. In Interglazial-Mitte gibt es eine Hasel-Spitze, gefolgt von Eibe, Hainbuche und Tanne zugleich mit Fichte (vgl. das Pollendiagramm in Klaus S. 325)
Nach der Riß-Eiszeit bildeten sich die dritten Seen: etwa der heutige Attersee und der damals um 60 m höhere (siehe Klaus 1975) Mondsee – der sich von Oberwang bis zum Zellersee und sogar bis nach Thalgau erstreckte (vgl. die Abbildung).
Es gibt Hypothesen (Ibetsberger 2010), die sich insbesondere auf Kohl (2000:149) beziehen, dass damals (vor ca. 80.000 Jahren) der Mondsee und der Attersee einen gemeinsamen See mit einer Seehöhe von 560 m über NN gebildet hätten. Das war aber nicht möglich, da die Riß-Moräne des Attersees – die heute etwa bei Lenzing liegt – nicht die erforderliche Höhe von zumindest 560 m hatte. Entsprechend den Höhenschichtlinien in DORIS hat diese Moräne eine maximale Höhe von 500 m über NN. Daraus ergibt sich, dass es keinen gemeinsamen See aus Mond- und Attersee geben haben konnte, da ja dann der Mondsee keine Höhe von 560 m hätte haben können. Dies bedeutet wahrscheinlich auch, dass der damals riesige Mondsee ursprünglich nach Norden zur Salzach entwässerte.
Unser heutiger vierter Attersees
Die Erniedrigung der Barriere zwischen Mondsee und Attersee muss sich gegen Ende des Riß/Würm-Interglazials oder erst durch den Würm-Gletscher während der letzten Eiszeit durch Abtragen von rd. 60 Höhenmetern Material bei See/Mondsee ereignet haben, mit der sich die vierten (heutigen) Seen Mondsee und Attersee etwa in heutiger Gestalt gebildet haben.
Die sedimentologische Entwicklung des Attersees seit der Eiszeit OFFEN
Der Attersee ist ein Beispiel für einen See, der im nördlichen Vorland der Nördlichen Kalkalpen liegt und während des Postglazials von verschiedenen sedimentliefernden Prozessen beeinflusst wurde. Die Sedimente des Beckens bestehen aus mehreren Komponenten unterschiedlichen Ursprungs.
Aus den Nördlichen Kalkalpen stammen Klastika, die hauptsächlich aus Dolomit bestehen. Der klastische Eintrag von organischen und anorganischen Partikeln erfolgt durch Flüsse und Erdrutsche. Sie sind für den Haupteintrag von Silikaten wie Quarz, Feldspat und Glimmer verantwortlich. Ein großer Teil des Sediments stammt aus autochthonen biogenen Karbonatausfällungen.
In den flachen sublitoralen Bereichen des nördlichen Teils des Sees dominiert die benthische Entkalkung durch verkrustende Makro- und Mikrophyten, während in den südlichen und zentralen Teilen des Sees die epilimnische Entkalkung durch die Blüte des Phytoplanktons im Sommer wichtiger ist. Die gesamte biogene Kalziumkarbonatproduktion erreicht etwa 11.000 bis 12.000 Tonnen pro Jahr.
Nährstoffe und Rückstände von Cyanophyten (Oscillatoria rubescens) aus dem eutrophen Mondsee wurden von der Mondseeache in den Attersee gespült. Hohe Phosphorgehalte in den Sedimenten des südlichen Beckens weisen auf eine lokale Eutrophierung im Mündungsbereich der Mondseeache hin. Die durchschnittliche Sedimentationsrate im Attersee kann durch verschiedene Datierungsmethoden bestimmt werden. Die Sedimentationsraten stiegen in den letzten 110 Jahren von 1 mm pro Jahr auf 1,8 - 2 mm pro Jahr als Folge menschlicher Aktivitäten.
Es lassen sich fünf Hauptphasen in der nacheiszeitlichen Sedimentationsgeschichte erkennen: Würmmoränen und fein gebänderte Varven (vor 13 000 v. Chr.), das frühe Attersee-Stadium (von 13.000 v. Chr. bis 800 n. Chr.) und das spätere Attersee-Stadium nach der bayerischen Besiedlung (ab 800 n. Chr.). Mit Hilfe von Schwermetall- und Isotopenanalysen kann die Sedimentationsgeschichte für die letzten 100 Jahre genauer rekonstruiert werden.
Behbehani, A. R., 1984: Sedimentologische Untersuchungen im südlichen Teil des Attersees (Österr. Kt. 1:25 000, Bl. 64/4 Unterach, Salzkammergut, Oberösterreich). Diplomarbeit, Univ. Göttingen, 137 p.
Behbehani 1986, Ahmad; Müller, J.; Schmidt, R.; Schneider, J.; Schröder, H.; Strackenbrodk, I.; Sturm, M.: → Sediments and sedimentary history of Lake Attersee (Salzkammergut, Austria). Hydrobiologia 143, December 1986, p. 233–246. (Historia, Grafiken usw.) → S. 235: Grafik Delta: Flysch vs. Moränen !!! UND: 9.1 WIEDERBEWALDUNG
- Hydrobiologia articles are published open access under a CC BY licence (Creative Commons Attribution 4.0 International licence). → Creative Commons
Schneider 1987, J., Müller, J., & Sturm, M.: Die sedimentologische Entwicklung des Attersees und des Traunsees im Spät- und Postglazial. Mitt. d. Komm. f. Quartärforschung der ÖAW, 7, Wien, 51–78
Schneider 1990,J., Röhrs J., Jäger P.: → Sedimentation and Eutrophication History of Austrian Alpine Lakes. In: Tilzer m. (1990): Large Lakes. Ecological Structure and Funktion. Springer Berlin, ISBN 978-3-642-84079-1; p. 316-335. (ATTERSEE letzte 15.000 Jahre)
- Within Austrian prealpine lakes the first natural eutrophication can be identified about 6,000 yr B. P. The Neolithic and the Roman colonizations had nearly no influence on these large lakes.
Älteste Vermessung des Attersees SIMONY OFFEN

Vertikale Temperaturverteilung im Atter-, Mond-, Traun-, Hallstättersee
Grims 1996, Franz: → Das wissenschaftliche Wirken Friedrich Simonys im Salzkammergut. Staphia Bd. 43, S. 43-71.
Simony 1850, Friedrich: → Die Seen des Salzkammergutes. Sitzung vom 10. Mai 1850; Sitzungsberichte der math.-naturwiss. Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien. (Sprungschicht im Hallstättersee usw.)
Simony, 1879, Friedrich: → Über Alpenseen Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, Bd. 19, Wien 1879; 41 Seiten. (Tiefenmessungen; vertikale Temperaturmessungen usw.)
"Dieselbe Erhebung findet sich in der Nähe von Nussdorf, wo aus dem 100 bis 150 Meter tiefen Seegrunde ein ziemlich umfangreicher Hügel bis gegen 60 Meter unter dem Wasserspiegel sich erhebt."
Simony hat diese Messungen 1848 durchgeführt (vgl. die Tabelle).
Kartographische Kleinarbeit sind einige Tiefenkarten der von ihm ausgelotheten Seen, sie zeichnen sich durch minutiöse Zeichnung der Isobathen aus . Von Atter- und Mondsee liegen nur Pausen vor.
Müllner 1898, Johann: → Die Seen des Salzkammergutes und die österreichische Traun – Monografien Allgemein – 0197:1–114 (Attersee S. 21–25; Nußdorfer Berg im See (60 m); Niederschläge Attersee: S. 102–104).
Arbeiten aus dem Labor Weyregg zur Seereinhaltung OFFEN
Datenblatt → Attersee 2007–2009
Limnologische Bibliographie zum Attersee: → 26 Literaturstellen bis 1980; viel von Univ. Göttingen.
Moog , Otto: → Seenreinhaltung - Attersee. (Daten, Limnologie etc.)
Datenblatt → Attersee 2007–2009
WIKIWAND: → https://www.wikiwand.com/de/Region_Attersee
6 Bände: → Arbeiten aus dem Labor Weyregg
Moog 1982, Otto: → Arbeiten aus dem Labor Weyregg 1982.
Schindlbauer, Gottfried: Agrargeographie des Atterseegebiets. Diss. 1981, Univ. Salzburg.
Schindlbauer 1982, Gottfried: → Das hydrographische Einzugsgebiet des Attersees – Geographische Untersuchungen als Grundlage für eine Nährstoffbilanzierung. Arbeiten aus dem Labor Weyregg Bd. 6, 1982. S. 17–56. (einzelne Bäche mit Fläche, Bevölkerung, Landwirtschaft usw.) HQ LITERATUR zu Geologie, Hydrologie, Landwirtschaft usw. [Desciption of surface structure taking in consideration geology and nature of soil.]
Schindlbauer 1986, Gottfried: → Das ländliche Siedlungsbild unter besonderer Berücksichtigung der Gehöftformen, dargestellt am Beispiel des Atterseegebietes. JBOÖMV 1986, S. 89–105.
Moog 1982, Otto: → Jahresgang von Phytoplankton und Chlorophyll a im Attersee 1981 – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 6_1982: 134–141 (Abb. S. 140)
Klima und Wetter: → Das Klima und durchschnittliche Wetter das ganze Jahr über am Attersee
Die häufigen Wasservögel am Attersee
Aubrecht 2003, Gerhard: → Höckerschwan – Denisia – 0007:124-125.
Aubrecht 2003, Gerhard: → Lachmöve Denisia – 0007:218-219.
Aubrecht 2003, Gerhard: → Haubentaucher – Denisia – 0007:110-111.
Schuster 2003, Alexander: → Blässhuhn – Denisia 0007:202–203.
Müller 1979, Günther, Otto Moog (1979): → Nahrung und Verteilung des Bläßhuhns am Mondsee. – Egretta 1979:1-3.
Aubrecht 2003, Gerhard: → Stockente, Denisia 0007:144–145.
Aubrecht 2003, Gerhard: → Tafelente Denisia – 0007:152-153.
Aubrecht 2003, Gerhard: → Reiherente Denisia – 0007:154-155.
Aubrecht 1978, Gerhard: → Ergebnisse von drei Wasservogelzählungen am Attersee im Winter 1977 – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 2_1978:128-136.
Aubrecht 1979, Gerhard; Gert Michael Steiner: → Wasservögel und Makrophyten am Attersee – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 3_1979:253-261.
Winkler 1984, Hans; Gerhard Aubrecht: → Zusammenhänge zwischen überwinternden Wasservögeln und die Beschaffenheit der Uferzone des Attersees. – Egretta – 27_1:23-30.
Aubrecht 1979, Gerhard: → Die Wasservögel des Attersees 1977 und 1978 - Diskussion der Ursachen für die zeitliche und räumliche Verteilung. – Jahrbuch OÖMV – 124a:193-238.
Aubrecht 1981, Gerhard; Otto Moog: → Die Entwicklung des Wasservogelbestandes im Attersee von Winter 78/79 bis Winter 80/81. – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 5_1981: 166 - 174.
Aubrecht 1982, Gerhard; Otto Moog: → Der Wasservogelbestand des Winterhalbjahres 1981/1982 am Attersee. – Arbeiten aus dem Labor Weyregg – 6_1982: 179 - 182.
Die Wasserpflanzen des Attersees
OÖ Landesregierung: → Phytoplankton im Attersee 2013. Attersee S. 10–39.
Pall 2010, Karin et al.: → Makrophytenkartierung Attersee – Bewertung nach WRRL. OÖ Landesregierung 2010, 38 Seiten.
- Makrophyten sind Gewächse, die mit bloßem Auge sichtbar sind. Diese umfassen die höheren Wasserpflanzen und die Armleuchteralgen. Zu den Wasserpflanzen werden nur die aquatischen Makrophyten, also die untergetaucht lebenden gezählt.
Jersabek 2021, Christian: → Ökologischer Zustand der Seen im Land OÖ; 198 Seiten. (Attersee-Phytoplankton; vorkommende Arten; Anzahl; OFFEN: Bilder)
Findenegg 1959, Ingo: → Das pflanzliche Plankton der Salzkammergutseen – Österreichs Fischerei – 12:32–35
Schifffahrt am Attersee OFFEN
Segelparadies Attersee OFFEN
Tauchparadies Attersee
Hois 2014, Harald, Kapfer Gerald: → Unterwasser - ein fotografischer Streifzug durch Seen, Flüsse und Bäche entlang der Ostalpen. Zs. Denisia Bd. 33:9–32. (schöne Unterwasser-Bilder)
Der Attersee gilt als Tauchmekka im Salzkammergut sowie im deutschsprachigen Raum. Der See gilt als das vielfältigste Tauchgewässer Österreichs und zählt zu den besten Süßwasser-Destinationen weltweit. Die Auswahl an Foto-Standorten richtet sich ganz nach den Wünschen der Fotografen: von der Architektur der Unterwasserkuppeln, Anlegestellen und Bootshäuser hin bis zu senkrecht abfallenden Steilwänden oder auch zu opulent bewachsenen Abhängen und Uferzonen reicht das Spektrum. Doch damit noch nicht genug: Schwarmphänomene wie der jährliche Laichzug der bis zu 1 m großen Perlfische (Abb. 27) oder die Millionen an Seelauben (Abb. 28) an den Hinkelsteinen sowie an weiteren Bachmündungen machen den Attersee einzigartig.
Wasser und dessen außergewöhnlichen physikalischen Eigenschaften
Das Wasser der Erde
Die Erde besitzt insgesamt 35 Milliarden km³ Wasser und bedeckt damit 71 % der Erdoberfläche – das sind 520 Millionen km².
Davon gibt es nur 24,3 Millionen km³ (= 0,7 ‰) in Form von Eis (Polareis, Gletscher, Schnee, Permafrost) und 10,5 Millionen km³ als Grundwasser. Nur 122.000 km³ sind in Süßwasserseen, Bodenfeuchte, Mooren/Sümpfen und Flüssen enthalten. Die Atmosphäre trägt 12.900 km³ Wasser.
Es lässt sich ermitteln, dass durch das Abschmelzen des Grönlandeises der Weltmeeresspiegel um rd. 6 m ansteigen würde. Unter der Annahme, dass alle Eismassen der Erde abschmelzen würden, stiege der Spiegel des Weltmeers um rd. 47 m an. (Anm.: Da der Meeresspiegel zum Höhepunkt der letzten Eiszeit um 120 m tiefer als heute lag, kann man schließen, dass damals gegenüber heute mehr als drei Mal so viel Wasser als Eis gebunden war.)
Dipol-Eigenschaft von Wassermolekülen
Wassermoleküle bestehen aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom (H2O). Da die Wassersstoffatome bei der Elektronenpaarbindung ihre Elektronen an das Sauerstoffatom abgeben, zeigen sie elektrisch eine positive Ladung und das Sauerstoffatom eine doppelte negative Ladung.
Da sich die positiv geladenen Wasserstoffatome seitlich in einem Winkel von 104,5° an das negativ geladene Sauerstoffatom anlagern – und nicht entlang einer geraden Linie – wirkt das Wassermolekül elektrisch als ein Dipol.
Wasserstoffbrücken durch Dipol-Dipol-Wechselwirkungen

Wasserstoffbrücken durch Dipol-Dipol-Wechselwirkungen
Die Wassermoleküle richten sich nun so aus, dass die Plus- und die Minus-Teilladungen zueinander zeigen und damit die einzelnen Wassermoleküle durch die elektrischen Anziehungskräfte stark aneinander gebunden werden. Jedes elektropositive Wasserstoffatom eines Wassermoleküls versucht, möglichst in der Nähe eines elektronegativen Sauerstoffatoms eines anderen Moleküls zu sein (das sind die sogenannten "Wasserstoffbrücken"; vgl. die obige Abbildung).
Diese Wasserstoffbrückenbildung führt zu Clustern von Wassermolekülen. Je niedriger die Temperatur des Wassers, umso mehr lagern sich die Moleküle aneinander, je höher die Temperatur umso weniger Brücken gibt es.
Auswirkungen der Wasserstoffbrücken

Oberflächenspannung wegen Wasserstoffbrücken
Wie der nebenstehenden Grafik entnommen werden kann, heben sich die elektrischen Anziehungskräfte im Wasserinneren auf. Demgegenüber bildet sich an der Wasseroberfläche eine Schicht, bei der die Wassermoleküle für die (positiv geladenen) Wasserstoffatome keine Kompensation mehr finden und es bildet sich eine durch elektrische Kräfte gebildete Oberflächenspannung.
Glückhafte – überhaupt Leben ermöglichende – Aggregatzustände
Ohne diesen Dipolcharakter und die dadurch hervorgerufenen Wasserstoffbrücken, die die einzelnen Moleküle stärker aneinander binden, wäre Wasser bei normalen Temperaturen keine Flüssigkeit sondern längst verdampft. Wasser hätte seinen Schmelzpunkt bei –100 °C und den Siedepunkt bei –80 °C.
Dann gäbe gäbe es aber kein Leben auf der Erde.
Bildung von Wassertropfen und Regen
Der obigen Grafik ist auch einfach zu entnehmen, dass sich bei ersten gebildeten kleinen Tropfen z.B. in einer Wolke an der Oberfläche eine positive elektrische Anziehungskraft der Wasserstoffatome für elektrisch negativ geladene Wasser-Sauerstoffatome in deren Nähe besteht und sich diese Wassermoleküle gerne an bestehende Wassertropfen angliedern - und damit das Wachsen von Regentropfen bewirken. Ohne diese Oberflächenspannung gäbe es keinen Regen, da sich keine größeren Wassertropfen bilden würden, deren Gewicht die Voraussetzung für Regen sind.
"Wasserläufer" sinken nicht ein
Wie in der Abbildung zu sehen ist, nutzen „Wasserläufer“ diese Oberflächenspannung, sodass sie über das Wasser laufen können ohne einzusinken. Zusätzlich haben sie Luftpolster an ihren Füßen, die ihnen zusätzlichen Auftrieb verleihen.
Dichte-Anomalie des flüssigen Wassers

Dichteanomalie des flüssigen Wassers
Nur bei Wasser steigt die Dichte beim Erwärmen von 0°C auf 4°C zunächst etwas an und beginnt erst dann zu sinken. Dieser Umstand ist lebensnotwendig für das Leben in Gewässern, denn das 4°C kalte Wasser sinkt nach unten. Die Gewässer können dadurch im Winter nicht vollständig durchfrieren und die Wassertiere können in der Nähe des Gewässerbodens überleben.
Die Dichteänderung von Wasser nimmt mit steigender Temperatur (vgl. die Grafik) rasch zu: Der Unterschied zwischen 24 und 25 °C ist dabei ungefähr 26-mal so groß, wie jener zwischen 4 und 5 °C. Als Faustregel kann gelten, dass Wasser bei 25 °C um rund 0,5 % leichter ist als bei 4 °C. Bei Seen resultiert daraus die große vertikale Schichtungsstabilität im Sommer.
Gleichzeitig bedeutet dies, dass nur im Frühjahr und im Spätherbst – wenn das (sauerstoffreiche) Oberflächenwasser und das Tiefenwasser gleiche Temperatur und damit gleiche Dichte haben – es zu einer Umwälzung des gesamten Seewassers kommt; nur dadurch wird ermöglicht, dass auch in großer Wassertiefe genügend Sauerstoff für Lebewesen vorhanden ist.
Dichte-Anomalie von Eis/Wasser
Im Allgemeinen hat ein Stoff im festen Zustand eine größere Dichte als im geschmolzenen Zustand: Ein Eisenstück sinkt in einer Eisenschmelze genauso auf den Boden wie eine Kerze in flüssigem Wachs. Eis dagegen schwimmt auf flüssigem Wasser, denn die Dichte von Eis ist mit 0,92 g/cm3 geringer als die Dichte von flüssigem Wasser (1 g/cm3). Eis ist daher bei 0 °C um rund 8,4 % leichter als Wasser. Dies bedingt auch, dass Seen von oben her zufrieren. Diese Anomalie ist darauf zurückzuführen, dass sich beim Gefrieren eine Gitterstruktur mit Hohlräumen bildet. In Form von Eis sind dadurch die Wasser-Teilchen weniger dicht gepackt als im flüssigen Wasser oder, was das gleiche bedeutet, Wasser dehnt sich beim Übergang in Eis um rund ein Elftel aus. Daher auch die Sprengwirkungen von in Rissen und Spalten gefrierendem Wasser.
Spezifische Wärme, Schmelzwärme und Verdunstungswärme
Spezifische Warme ist die Energiemenge, um 1 kg eines Stoffes um 1 °C zu erwärmen. Bei Wasser ist das die Definition einer „Kilokalorie“ (1 kcal = 4,1868 kJ) für die Erwärmung von 1 kg Wasser von 14,5 auf 15, 5 °C. Die vergleichsweise hohe spezifische Wärme von Wasser bedeutet, dass hohe Wärmemengen gespeichert werden und damit z.B. große Wasserkörper das Klima stark beeinflussen. Zugleich ergibt sich daraus, dass Wasser ein hohes thermisches Puffervermögen gegenüber tages- und/oder jahreszeitlichen Temperaturschwankungen besitzt.
Gegenüber Wasser hat Eis eine geringere spezifische Wärme von nur 0,49 kcal/kg (= 2,04 kJ/kg) um (kaltes) Eis um 1 °C (z.B. von -8 °C auf -7 °C) zu erwärmen.
Demgegenüber beträt die spezifische Schmelzwärme von Eis zu Wasser mit 80 kcal/kg (= 335 kJ/kg) ein Vielfaches.
Da beim Verdunsten die Wasserstoffbrücken überwunden werden müssen, lässt sich Wasser nur mit sehr hohem Energieaufwand verdunsten: um 1 Liter Wasser zu verdunsten sind 539 kcal/kg (= 2.257 kJ/kg) Energie erforderlich.
Die spezifischen Wärmen je kg (und °C) von Eis-Erwärmen : Eis-Schmelzen : Wasser-Erwärmen : Wasser-Verdampfen verhalten sich zueinander wie 0,5 : 80 : 1 : 539.
Wassertemperatur und Gewässer
Butz 1985, Ilse: → Wassertemperatur und Gewässer 1. Teil – Österreichs Fischerei – 38:65-68. → 2. Teil – Seite:144–148; → 3. Teil – Seite:196–199; → 4. Teil – Seite 241–244
Zugefrorener Attersee und Bodensee 1962/63
Einsele 1963, Wilhelm: → Der Winter 1962/63, die Gewässer und die Fischerei – Österreichs Fischerei – 16: 67.
Einsele 1963, Wilhelm: → Am 31. März 1963 ging das Eis im Attersee unter! – Österreichs Fischerei – 16:68–72. (Eisbruch)
Wagner 1963, Gustav: → Die totale "Seegfrörne" des Bodensees im Winter 1962/63 – Österreichs Fischerei – 16:73–74.
Jährlich zweimalige Vollzirkulation des Atterseewassers
Das gesamte Attersee-Wasser durchmischt sich wegen der Tiefe des Attersees zwei Mal pro Jahr ("Vollzirkuation").
Im Sommer gibt es eine scharfe Trennung des warmen Oberflächenwassers gegenüber dem jahresdurchgängig 4 °C kalten Tiefenwasser.

Herbstliche Verdunstung am Attersee am 2.11.2023 bei Wassertemperatur 15 °C und Lufttemperatur 5 ° C
Im Herbst gibt der See seine Wärmeenergie vorrangig mittels Verdunstung an die kältere Luft ab. Da die Verdunstungswärme des Wassers sehr hoch ist, kommt diesem Effekt das Hauptgewicht der Wärmeabgabe zu (vgl. die nebenstehende Abbildung).
Im Verlauf des Winters kommt es dann zu einer Angleichung der Temperatur des Oberflächen- und des Tiefenwassers mit ca. 4 °C. Damit wird die erste Zirkulation des Wassers des gesamten Attersees ermöglicht, die durch Wind und Wellen begünstigt wird.
Im Verlauf des Winters kühlt das Oberflächenwasser weiter ab (von 4 °C auf bis zu 0 °C), sodass es wiederum zu einer Trennung von Oberflächen- und Tiefenwasser kommt.
Im Frühjahr kommt es mit der Erwärmung des Oberflächenwassers auf wiederum 4 °C zur gleichen Situation wie im Winter mit gleicher Temperatur von Oberflächen- und Tiefenwasser, sodass es zu einer zweiten Zirkulation des gesamten Atterseewassers kommt.
Diese zweifache Zirkulation des Seewassers bewirkt, dass auch in den kalten Tiefen des Attersees ganzjährig Wasser mit hohem Sauerstoffgehalt vorhanden ist.
Nur in diesem seit der Eiszeit ganzjährig kalten und sauerstoffreichen Tiefenwasser unseres Attersees konnten unsere eiszeitlichen Fischarten Reinanke und Kröpfling und Seesaibling bis heute überleben: diese beiden Fischarten sind seit rd. 12.000 Jahren die einzigen direkten Nachkommen der Fische der Eiszeit in unserem damals erst entstandenen Attersee.
In Seen mit geringer Wassertiefe kommt es zu keiner scharfen Trennung von Oberflächen- und Tiefenwasser, wenn das warme Oberflächenwasser bis zum Grund des Sees reicht. Damit wird dieser Wasserkörper laufend bis zum Grund durchmischt und hat in seiner gesamten Tiefe ähnliche Temperatur. Die Nachkommen mancher eiszeitlicher Salmoniden in diesen Seen haben sich offenbar an solche Verhältnisse angepasst.
Da biologische Prozesse bei höheren Temperaturen rascher ablaufen – entsprechend einer Verdopplung je 10 ° Temperaturerhöhung – haben diese „Warmwasser-Salmoniden“ einen höheren Stoffumsatz und wachsen schneller als die „Kaltwasser-Salmoniden“ des Attersees.
[Anm. laut → Fischereirevier Attersee: "Die Fangtiefe für Attersee-Maränen liegt zw. 10 und 20 m. Tiefeneinstellung im Frühjahr 10–14 m; im Herbst 16–20 m. Im Frühjahr lohnt sich aber auch Flachwasser mit 5 m Wassertiefe."]